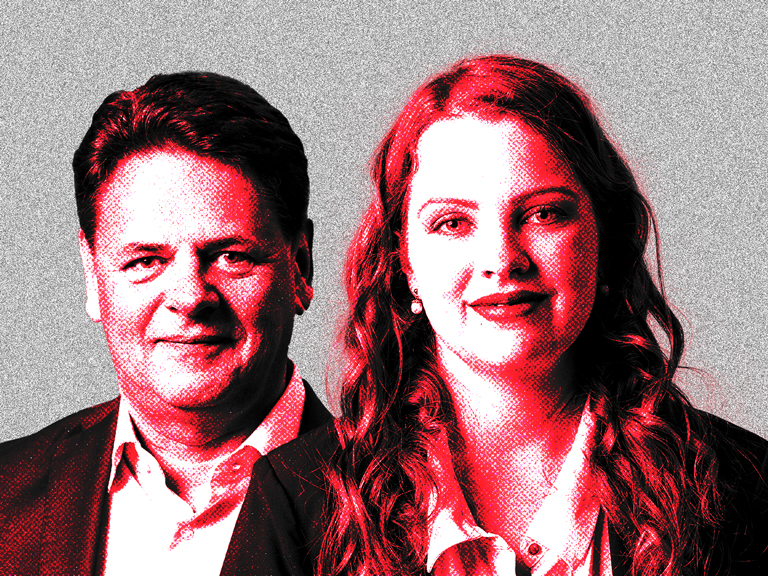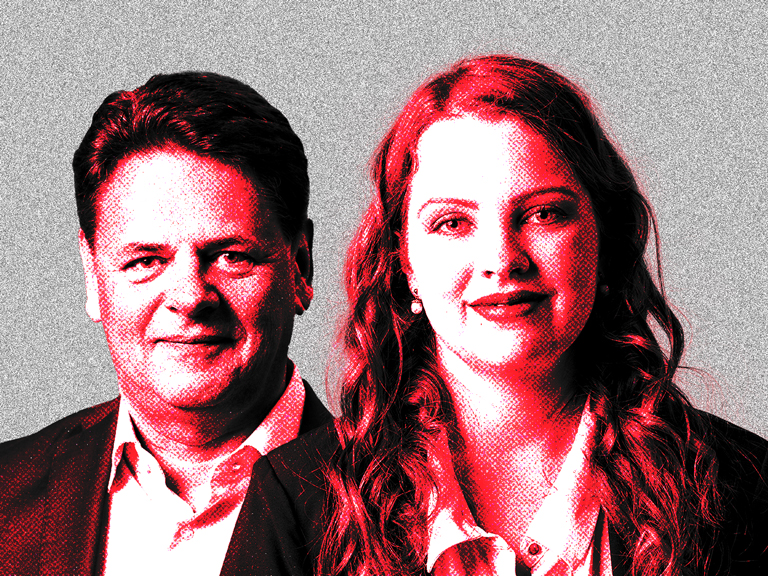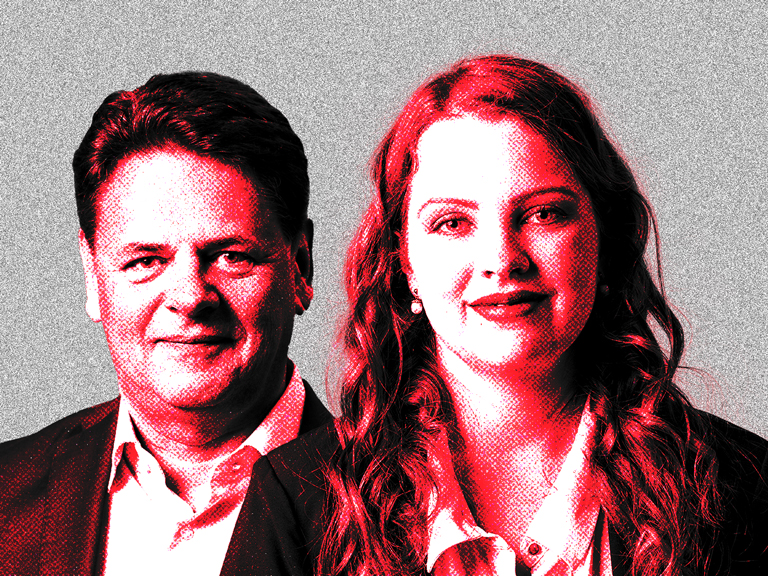Politkolumne
Wie können Sie es mit Ihren Nachbarinnen und Nachbarn?
In der Schweiz fühlen sich nur noch 10 Prozent mit ihrer Nachbarschaft verbunden. Dabei würden gerade Jüngere davon profitieren.

Diese Woche wurde ich aufgeschreckt. Laut jüngsten Umfragen fühlt sich nur noch rund ein Zehntel der Menschen in der Schweiz wirklich eng mit der Nachbarschaft verbunden. Keine guten Nachrichten für Raumplaner und Quartiersmanagerinnen.
Wie ist das bei Ihnen? Was halten Sie von Ihren Nachbarinnen und Nachbarn? Leben Sie gerne in Ihrer Nachbarschaft?
Mein eigenes Wohnumfeld kann als Abziehbild eines starken sozialen Zusammenhalts herhalten. Gespickt mit einem fast schon blinden zwischenmenschlichen Vertrauen unterstützen sich die Bewohnerinnen und Bewohner gegenseitig, wo sie nur können.
Sie teilen eine gemeinsame Identität und spüren ein Gefühl der Zugehörigkeit zu ihrer Nachbarschaft. Notabene nicht in einem überschaubaren Dorf, sondern im Umfeld einer anonymen Stadt, wo nicht allen alle Vornamen geläufig sind und in dem vielfältige Fluchtwege das Gesetz des Wiedersehens unterwandern können.
Jüngstes Anschauungsbeispiel ist ein Jahrhundertspektakel direkt vor meiner Haustür. Die Idee, ein Nachbarschaftsfest anlässlich eines runden dreistelligen Geburtstags der Siedlung durchzuführen, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Anstatt die Ellbogen auszufahren, werden Arme und Hände gereicht: Die Arbeit am Gemeinsamen lässt die Bewohnerinnen und Bewohner der verrufenen Grossstadt mit dem Löwenwappen zu Schmusekatzen werden. Seit Monaten ziehen die Vorarbeiten das Quartier in ihren Bann und lassen Jung und Alt Zusammengehörigkeit spüren.
Junge profitieren von intakten Nachbarschaften
In Zeiten, in denen welkende Gemeinwohlorientierung und wuchernde Ich-Bezogenheit lamentiert werden, wird hier Tür an Tür soziales Kapital geschaffen. Ein Vermögen, das übrigens auch Auszahlungen für jene bereithält, die nichts oder nur wenig in das Miteinander investieren.
Die Vorteile eines intakten Wohnungsumfelds werden in Studien gerade auch für junge Bewohnerinnen und Bewohner immer wieder hervorgehoben. Speziell engmaschige Vernetzungen und Gemeinschaftsaktivitäten in Nachbarschaften prägen als soziale Brutstätten nicht nur die Lebenswege und Bildungschancen, sondern auch das Wohlbefinden und das Verhalten der Heranwachsenden, die dort leben.
Allerdings entpuppt sich nicht jede Nachbarschaft als Wohlfühloase. Mancherorts wird sie gar zum Minenfeld. So hatte in der Schweiz fast jede dritte Person schon Streit mit den Nachbarinnen und Nachbarn. Am häufigsten werden Lärmbelästigung, Probleme mit der Waschküche, das Ignorieren der Parkordnung und Grundstückstreitigkeiten als Grund angeführt.
Eigene Zahlen verraten, dass rund 40 Prozent der Schweizer Bevölkerung ihren Nachbarinnen und Nachbarn ein gewisses Mass an Vertrauen entgegenbringen. Fremden gegenüber sind wir sehr viel misstrauischer. Ein Blick über die Landesgrenzen verrät, dass in Deutschland mehr Menschen und in Frankreich und Italien weniger Personen ihrer Nachbarschaft Vertrauen schenken als hierzulande.
Wer sich selbst als extrovertiert und verträglich einstuft, hat in der Regel kein Problem damit, seinen Nachbarinnen und Nachbarn über den Weg zu trauen. Das Gleiche lässt sich für Vereinsmitglieder und emotional stabile Personen sagen.
Auch mit zunehmendem Alter und Bildung steigt die Bereitschaft, den Menschen in der Nachbarschaft zu vertrauen. Aber je weiter rechts man sich im Politspektrum verortet, desto eher gilt für Herrn und Frau Schweizer: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Sollten Sie in dieser Frage selbst noch unsicher sein, liefere ich Ihnen gerne eine Orientierungshilfe: Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass Sie Ihr Portemonnaie zurückbekommen, wenn Sie es mit Ihrer Identitätskarte und 300 Franken in der Nachbarschaft verlieren?
Zweitveröffentlichung
Tamedia-Kolumnen auf uniAKTUELL
Die Tamedia-Kolumnen von Markus Freitag sowie von Adrian Vatter und Rahel Freiburghaus erscheinen auch im uniAKTUELL.
Zum Institut für Politikwissenschaft (IPW) der Universität Bern
Das IPW ist eines der führenden politikwissenschaftlichen Institute der Schweiz. Es betreibt sowohl Grundlagenforschung als auch praxisrelevante Auftragsforschung. Deren Kernaussagen sind Bestandteil der angebotenen Studiengänge Bachelor «Sozialwissenschaften» und Master «Politikwissenschaft» sowie des schweizweit einzigartigen Studiengangs «Schweizer Politik im Vergleich». Schwerpunkte in Lehre und Forschung sind Politische Institutionen und Akteure, Europäische Politik, Klima, Umwelt und Energie, Öffentliche Meinung sowie Gender in Politik und Gesellschaft. Darüber hinaus bietet das IPW Dienstleistungen für die Öffentlichkeit an, wie zum Beispiel das Jahrbuch Schweizerische Politik (Année Politique Suisse).
uniAKTUELL-Newsletter abonnieren

Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.