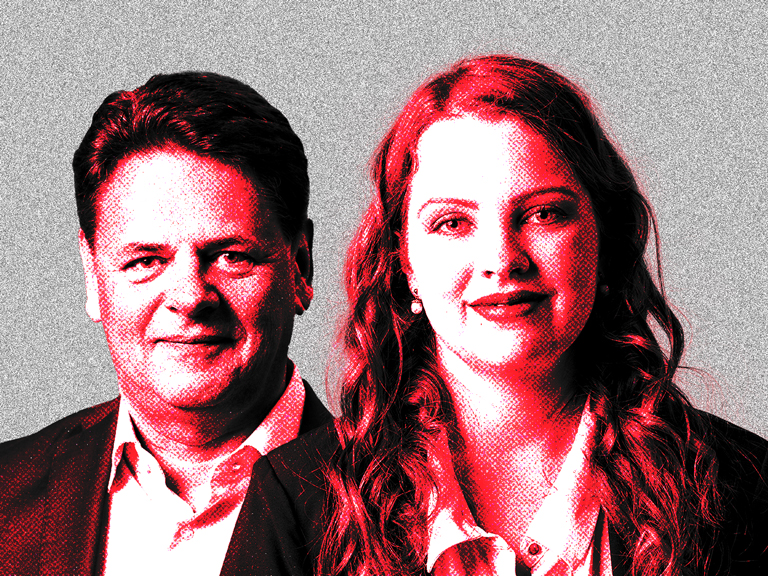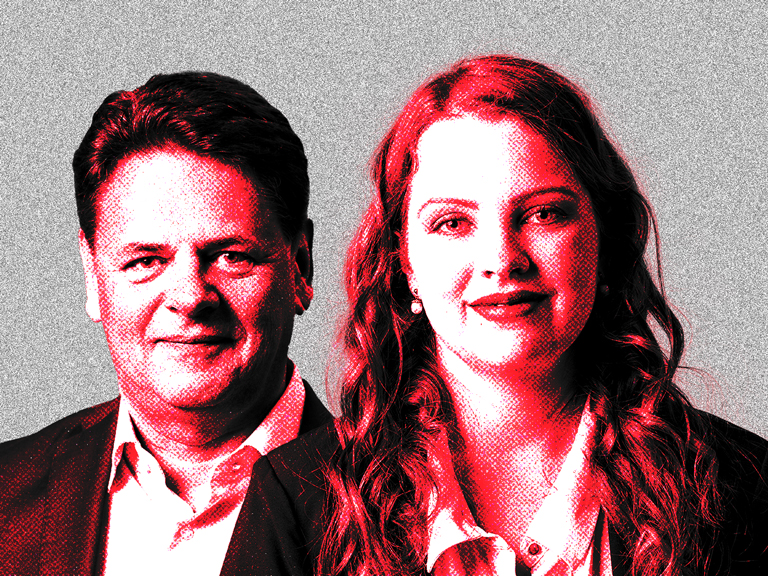Kolumne «Schweizer Herzfrequenzen»
Santé, Schweiz!
Verglichen mit Italien, Frankreich oder Deutschland ist die Schweiz eine Wohlfühloase – auch was die Selbstbewertung der Gesundheit angeht.

Gesundheit scheint die Befindlichkeit der Stunde. Quer durch alle Altersgruppen ordnen wir ihr fast alles unter, denn mit Gesundheit verbinden wir Positives wie Fitness, Zufriedenheit oder auch Lebensfreude. Unser Wohlbefinden bemisst sich allerdings schon lange nicht mehr allein an der Abwesenheit von Husten und Kopfschmerzen.
So definiert die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Gesundheit beispielsweise seit 1946 als einen Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht als das blosse Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Damit mausert sich unser Wohlergehen zur täglichen Baustelle und für viele sogar zum Lifestyle-Ziel. Wir wissen inzwischen, wie viele Schritte am Tag unser Leben verlängern.
Lang lebe die Longevity. Schliesslich ist Sitzen das neue Rauchen. Deshalb einmal direkt gefragt: Wie geht es Ihnen heute? Wie beurteilen Sie Ihren Gesundheitszustand? Fühlen Sie sich wohl?
Die subjektive Gesundheitsbewertung erfasst die Einschätzung der eigenen körperlichen und psychischen Verfassung. Sie ergänzt andere, stärker objektiv ausgerichtete Indikatoren des Wohlbefindens wie die körperliche Funktionsfähigkeit oder diagnostizierte Krankheiten und ist ein zentrales Mass gesundheitsbezogener Lebensqualität. Unsere Gesundheit hängt damit nicht ausschliesslich von objektiven Werten wie Blutdruck oder anderen Laborparametern ab, sondern ist auch eng mit der Selbstwahrnehmung, der Stimmungslage oder der Qualität sozialer Beziehungen verknüpft.
Subjektive Gesundheitsbewertung
Ein entscheidender Einflussfaktor ist hierbei die psychische Gesundheit. Depressive Symptome, Angststörungen oder chronischer Stress können das subjektive Gesundheitsgefühl stark beeinträchtigen, selbst wenn keine organische Erkrankung vorliegt. In einer Zeit, in der Selbstoptimierung das Leben vieler Menschen prägt, wird die subjektive Sicht auf die eigene Gesundheit zudem immer wichtiger. Menschen mit einer guten subjektiven Gesundheitsbewertung leben auch länger – und das zeigt sich interessanterweise auch unabhängig von ihrer objektiven Verfassung.
Aber aufgepasst: Wer aus übermässiger Angst vor gesundheitlichen Problemen ständig in sich hineinhört, jedes Ziehen im Magen als Hinweis auf eine schwere Krankheit googelt oder in Krankheitsforen liest, bis er einschläft, kann sich tatsächlich krank fühlen – ohne dass je etwas diagnostiziert wird. Menschen mit Hypochondrie erleben daher am eigenen Leib, wie tiefgreifend subjektives Wohlbefinden das Leben beeinflusst.
Verglichen mit Italien, Frankreich oder Deutschland ist die Schweiz eine Wohlfühloase. Hierzulande beurteilen nämlich über vier Fünftel ihren Gesundheitszustand als gut oder sehr gut, während dies in den Nachbarländern nur maximal zwei Drittel tun. Allerdings sind die persönlichen Gesundheitsbewertungen in der hiesigen Bevölkerung ungleich verteilt, wie eigene Auswertungen zeigen.
Gesundheit – auch eine Frage des Einkommens
So fühlen sich Schweizerinnen und Schweizer beispielsweise mit zunehmendem Alter weniger auf dem Damm. Eine finanzielle Schieflage schlägt ihnen ebenfalls auf den Magen: Wer mit seinem Einkommen nicht recht über die Runden kommt, fühlt sich auch nicht wirklich gesund. Gleiches gilt für diejenigen, die introvertiert sind, sich verschlossen zeigen und vom Charakter her emotional instabil sind.
Und wer meint, im Vergleich zu anderen zu kurz zu kommen und in der gesellschaftlichen Hierarchie unten zu stehen, sieht sich auch gesundheitlich nicht auf der Höhe. Hinzu kommt: Menschen, die sich unwohl fühlen, versprechen sich auch von der Demokratie keine heilende Wirkung. Bleiben Sie also bei Kräften!
Zweitveröffentlichung
Tamedia-Kolumnen auf uniAKTUELL
Die Tamedia-Kolumnen von Markus Freitag sowie von Adrian Vatter und Rahel Freiburghaus erscheinen auch im uniAKTUELL.
Zum Institut für Politikwissenschaft (IPW) der Universität Bern
Das IPW ist eines der führenden politikwissenschaftlichen Institute der Schweiz. Es betreibt sowohl Grundlagenforschung als auch praxisrelevante Auftragsforschung. Deren Kernaussagen sind Bestandteil der angebotenen Studiengänge Bachelor «Sozialwissenschaften» und Master «Politikwissenschaft» sowie des schweizweit einzigartigen Studiengangs «Schweizer Politik im Vergleich». Schwerpunkte in Lehre und Forschung sind Politische Institutionen und Akteure, Europäische Politik, Klima, Umwelt und Energie, Öffentliche Meinung sowie Gender in Politik und Gesellschaft. Darüber hinaus bietet das IPW Dienstleistungen für die Öffentlichkeit an, wie zum Beispiel das Jahrbuch Schweizerische Politik (Année Politique Suisse).
uniAKTUELL-Newsletter abonnieren
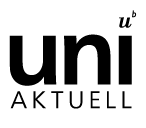
Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.