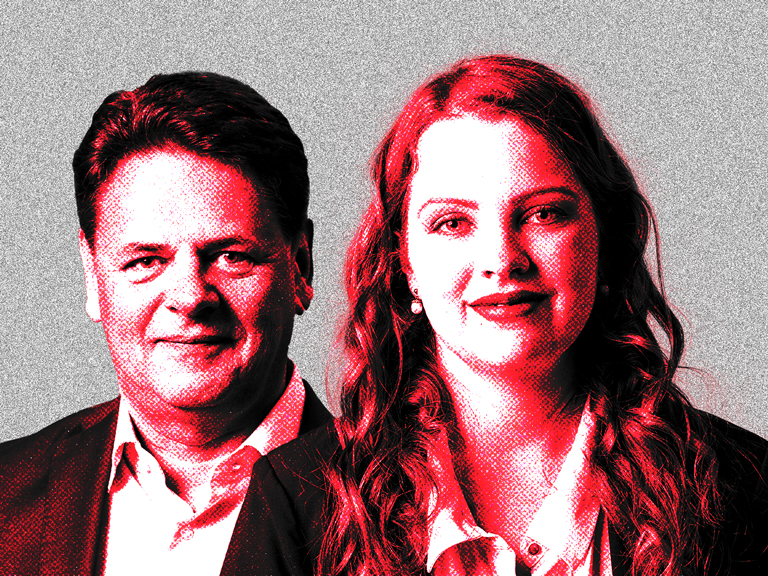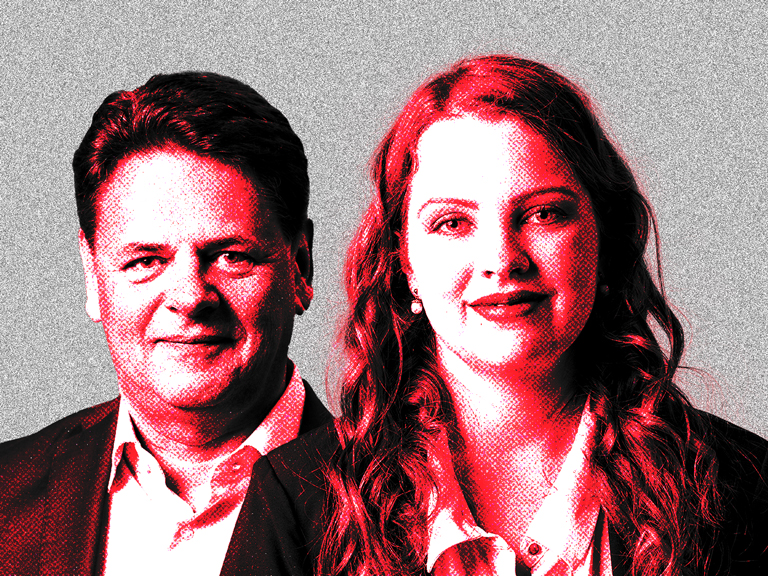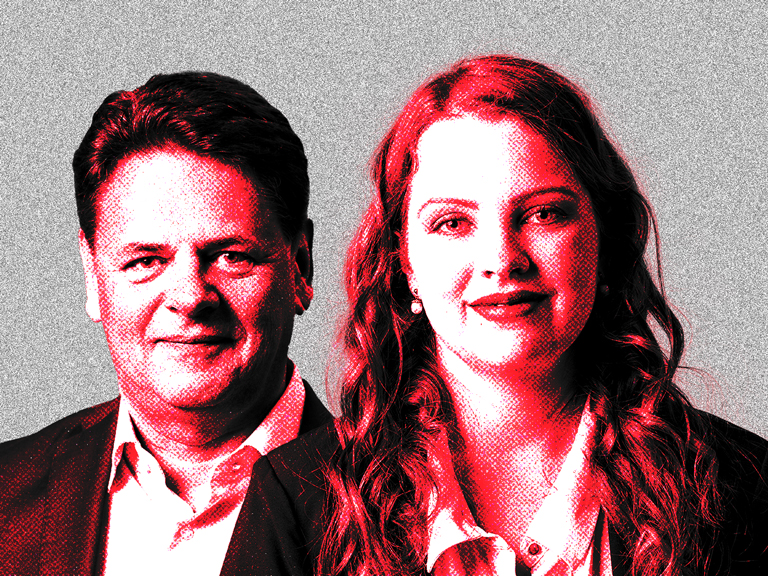Politkolumne
Warum die Schweiz bei Autokraten ins Straucheln gerät
Wenn Autokraten Druck machen, sucht die Schweiz den Konsens. Das ist innenpolitisch klug und aussenpolitisch fatal.
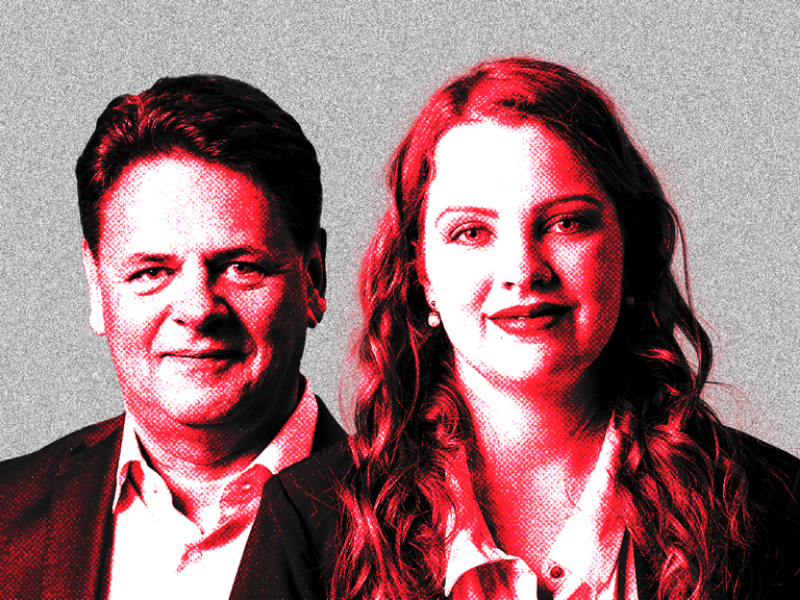
Autokratische und autoritäre Machthaber wie Donald Trump stehen für eine Politik der Unberechenbarkeit, der kurzfristigen Interessenmaximierung und der demonstrativen Geringschätzung internationaler Regeln. Verträge sind für sie nur taktisches Werkzeug, multilaterale Abkommen Ballast, und ohnehin gilt das Recht des Stärkeren. Wer ihnen begegnet, braucht bestenfalls gleichwertige Machtressourcen oder einen konsequenten Wertekompass. Beides ist kein Garant für Erfolg – und die Schweiz verfügt ohnehin über keines von beiden. Genau darin liegt ihre strukturelle Verwundbarkeit.
Vier Strategien im Umgang mit Autokraten
Die aktuelle Eskalation mit Trump ist nämlich alles andere als ein Einzelfall. Betrachtet man das aussenpolitische Verhalten der Schweiz in Drucksituationen genauer, lassen sich vier wiederkehrende Muster erkennen:
Kuschen: zeigte sich exemplarisch in der Libyen-Affäre (2008–2010), eigentlicher Protoyp für die institutionelle Überforderung der Schweiz im Umgang mit Autokraten. Als 2008 Hannibal Ghadhafi, der Sohn des libyschen Diktators, wegen Misshandlung seines Personals in Genf verhaftet wurde, reagierte das libysche Regime mit der Inhaftierung zweier Schweizer und massiven wirtschaftlichen Drohungen. Der Bundesrat war tief gespalten über die Reaktion. Trotzdem reiste Bundesrat Hans-Rudolf Merz im August 2009 im Alleingang nach Tripolis und entschuldigte sich öffentlich beim Regime. Dies geschah ohne Rückhalt des Gesamtbundesrats und ohne Konsultation der Aussenpolitischen Kommissionen. Das Ziel: Deeskalation. Das Resultat: diplomatische Blamage und innenpolitische Empörung.
Kooperieren prägte die Beziehungen der Schweiz zur chilenischen Militärdiktatur (1973–1990). Zum Pinochet-Regime pflegte die Schweiz in den 1970er-Jahren auffallend freundschaftliche Beziehungen unter dem Vorwand der «guten Dienste». 1977 empfing Bundesrat Kurt Furgler den chilenischen Aussenminister Patricio Carvajal zu offiziellen Gesprächen in Bern. Unter dem Deckmantel neutraler Vermittlung dominierten wirtschaftliche und handelspolitische Überlegungen.
Profitieren – das tat die Schweiz beispielsweise von der argentinischen Militärdiktatur (1976–1983). Während General und Diktator Jorge Rafael Videla an die 30’000 Menschen verschwinden liess, hielt die Schweiz unbeirrt am Handel fest – exportierte Maschinen und Finanzdienstleistungen. Historische Handelsdaten und diplomatische Quellen belegen, dass die wirtschaftliche Neutralität in der Praxis einer politischen Zustimmung zur Junta gleichkam.
Widerstehen bedeutete in der Schweizer Aussenpolitik, autoritären Regimes trotz wirtschaftlicher oder diplomatischer Nachteile Paroli zu bieten. Selten, aber es kam vor. 2005 empfing Bundesrat Pascal Couchepin den Dalai Lama in der Schweiz, sehr zum Ärger Pekings. Dies war aufgrund der Vorgeschichte besonders heikel, da 1999 der damalige chinesische Premierminister Jiang Zemin bei seinem Staatsbesuch wutentbrannt der Schweiz die Freundschaft aufgekündigt hat, nachdem protibetische Aktivisten neben dem Bundesplatz für die Unabhängigkeit Tibets demonstriert hatten. Gemeinsamer Nenner dieser seltenen Episoden: Die Schweiz akzeptierte kurzfristige Kosten, um einen politischen oder völkerrechtlichen Grundsatz zu wahren.
uniAKTUELL-Newsletter abonnieren
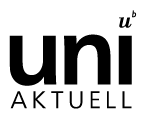
Entdecken Sie Geschichten rund um die Universität Bern und die Menschen dahinter.
Gefangen in der Langsamkeit
Die institutionelle Stärke der Schweiz ist zugleich ihre Achillesferse. Denn das innenpolitische Prinzip der Konkordanz, kombiniert mit Föderalismus und direkter Demokratie, garantiert Stabilität im Normalbetrieb, wird aber im aussenpolitischen Krisenmodus zum Hindernis. Im Ergebnis führt diese «institutionelle Langsamkeit» der innenpolitischen Entscheidungsprozesse zu einer reaktiven Aussenpolitik: pragmatisch und oft ad hoc, in stabilen Zeiten funktional, im Krisenmodus jedoch anfällig für Verzögerungen und fehlende strategische Ausrichtung.
Damit ist die Schweiz in bester Gesellschaft. Laut der breit angelegten Studie der beiden US-Politologen Navin A. Bapat und T. Clifton Morgan sind es just solche «Systeme mit fragmentierten Entscheidungsstrukturen», die deutlich seltener zu Wirtschaftssanktionen und Gegenmassnahmen bereit sind, die Autokraten in Schranken weisen würden. Und wenn sie es tun, weniger Durchhaltevermögen beweisen.
Zweitveröffentlichung
Tamedia-Kolumnen auf uniAKTUELL
Die Tamedia-Politkolumnen von Adrian Vatter und Rahel Freiburghaus sowie Markus Freitag erscheinen auch im Online-Magazin der Universität Bern uniAKTUELL.
Zum Institut für Politikwissenschaft (IPW) der Universität Bern
Das IPW ist eines der führenden politikwissenschaftlichen Institute der Schweiz. Es betreibt sowohl Grundlagenforschung als auch praxisrelevante Auftragsforschung. Deren Kernaussagen sind Bestandteil der angebotenen Studiengänge Bachelor «Sozialwissenschaften» und Master «Politikwissenschaft» sowie des schweizweit einzigartigen Studiengangs «Schweizer Politik im Vergleich». Schwerpunkte in Lehre und Forschung sind Politische Institutionen und Akteure, Europäische Politik, Klima, Umwelt und Energie, Öffentliche Meinung sowie Gender in Politik und Gesellschaft. Darüber hinaus bietet das IPW Dienstleistungen für die Öffentlichkeit an, wie zum Beispiel das Jahrbuch Schweizerische Politik (Année Politique Suisse).