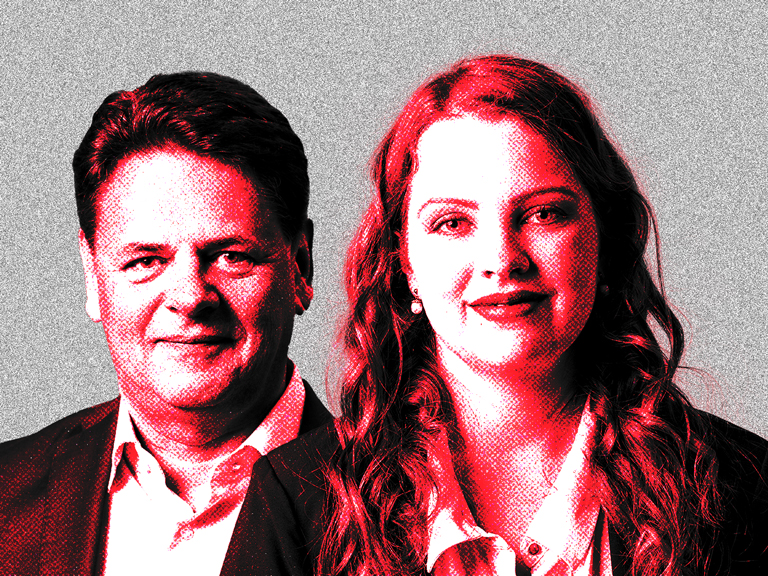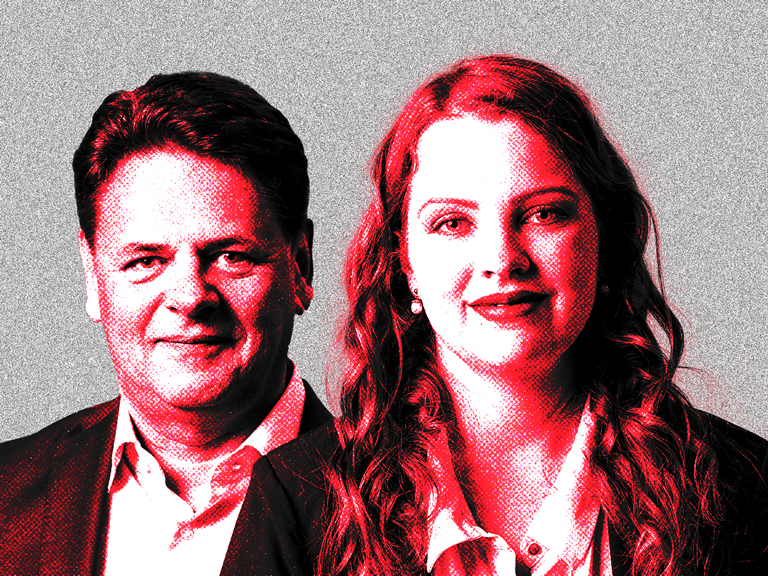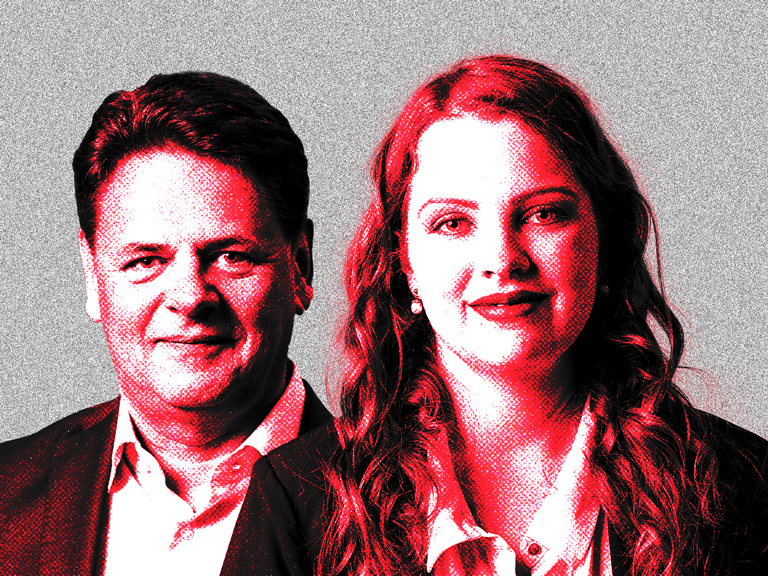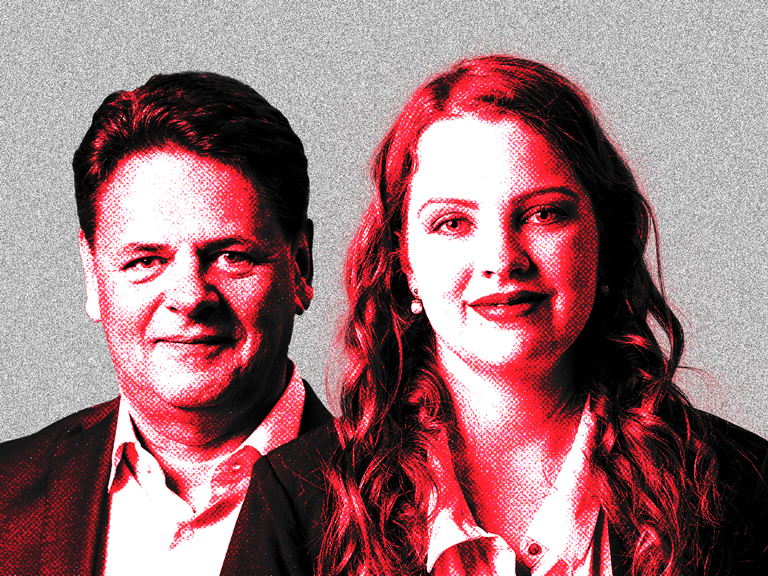Politkolumne
Letzte Patrone gegen Rechtsextremismus: Parteiverbote oder politische Eindämmung?
Rechtsextreme Parteien am Gericht zu stoppen, garantiert keine Sicherheit für liberale Demokratien. Gefragt sind vielmehr Abgrenzung, Proteste und ein starker Service public.
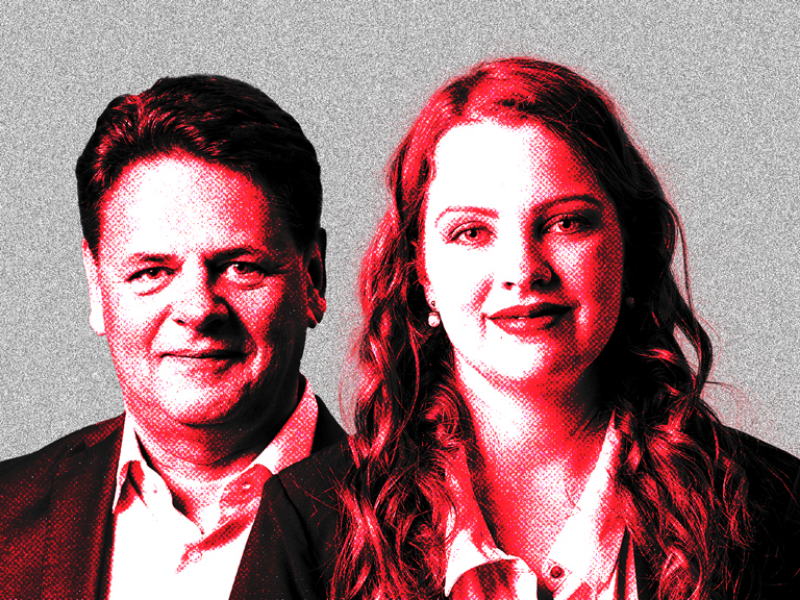
Marine Le Pen wurde mit einem fünfjährigen Amtsverbot belegt, um sie wegen Veruntreuung von EU-Geldern zu büssen. In Brasilien darf Jair Bolsonaro acht Jahre nicht zu Wahlen antreten. Und in den USA sollen nun Gerichte Donald Trump bei der Umsetzung des «Project 2025» stoppen.
Derweil sieht man in Deutschland «Endzeitstimmung» aufkommen. Bei der vierten schwarz-roten Koalition in zwei Jahrzehnten handle es sich um «die letzte Patrone der Demokratie» (Markus Söder). Sie sei die «vielleicht letzte Chance» (Friedrich Merz), Wähler von der vom Bundesamt für Verfassungsschutz Anfang Mai 2025 als gesichert rechtsextremistisch eingestuften AfD zurückzugewinnen.
Mehr als je zuvor stehen westliche Demokratien vor einer existenziellen Frage: Rechtsextremismus juristisch bekämpfen – oder politisch stellen?
Juristische Strategien – wie weit tragen sie (noch)?
Juristische Strategien nutzen das bestehende Recht, um die Aktivitäten rechtsextremer Parteien rechtlich zu unterbinden.
Neue Daten zeigen: Die Zustimmung zu einem Verbot von Parteien, die «undemokratische Massnahmen» verfolgen, ist in Ländern mit einer Parteienverbotsgeschichte am höchsten. Dazu zählen etwa Israel, Deutschland und die Schweiz. Die Bevölkerung will vor allem jene Parteien verbieten, die Terrorismus gutheissen oder Diskriminierung fördern. Hingegen sind die Wähler eher bereit, ein Auge zuzudrücken, wenn eine Partei Gerichte mit loyalen Richtern besetzt.
Ob die im Volk durchaus mehrheitsfähigen juristischen Hebel wirksam sind, ist eine ganz andere Frage. So dokumentiert der Stanford-Politologe Adam Bonica, dass die Trump-Administration in zwei von drei Fällen gegen konservative «district judges» verliert. Aber je höher die gerichtliche Ebene, desto weniger sind konservative Richter gewillt, die amerikanische Demokratie vor der Ausweitung der präsidentiellen Macht zu schützen. Sie opfern die Verteidigung des Rechtsstaates ihren eigenen Karrieregelüsten. Wer am Appellationsgericht «trumpfeindlich» urteilt, verdient sich keine Nominierung für die begehrte Richterbank am Supreme Court.
Auch Parteienverbote sind nicht per se ein Sicherheitsventil für die Demokratie. Es spielt der Faktor Zeit. «Je länger die Demokraten abwarteten, umso schwieriger wurde es», schreibt der FAZ-Redaktor Justus Bender zum 1930 versuchten NSDAP-Verbot. Beweise lagen seitenweise vor, doch Reichskanzler Heinrich Brüning agierte zu zögerlich.
Politische Strategien – es gibt sie noch
Derweil zielen politische Strategien darauf ab, rechtsextreme Parteien in ihrer Wirkung einzudämmen und ihre Unterstützung in der Bevölkerung zu verringern.
Wenn Mitte-rechts die Positionen ihrer Konkurrenz am rechten Rand kopiert, stärkt das diese nur. Politikwissenschaftlich ist dies längst gut belegt. Neuer ist die Erkenntnis, dass auch die Übernahme populistischer Rhetorik ins Leere zielt. Derartige Kommunikations- und Kampagnenstrategien können Wähler laut einer italienischen Studie sogar endgültig von der Demokratie entfremden. Gefragt ist also erstens eine klare inhaltliche und kommunikative Abgrenzung gegen rechtsextrem.
Zweitens schmälern Proteste im nur vermeintlich Kleinen den Wahlerfolg rechtsextremer Parteien nachweislich. Als besonders wirksam erweist sich ein «Tango» zwischen Aufmärschen Rechtsextremer und Gegenmobilisierung – gerade auch im nur vermeintlich Kleinen des lokalen Raums. In Griechenland sank der Wähleranteil für die «Goldene Morgenröte» so um bis zu 16 Prozentpunkte. Ähnliches ist für Italien, Deutschland oder Frankreich belegt.
Und drittens braucht es starke Verwaltungen, die handfeste Verbesserungen für alle Menschen schaffen. Umgekehrt legen rechtsextreme Kräfte in Orten zu, wo der Service public abgebaut wird und mit dem ÖV schlecht erschlossen sind. Global gesehen gewinnen Verwaltungen an Vertrauen, während jenes in Regierungen, Parlamente und Parteien schwindet. Diesen Vorschuss gilt es zu nutzen – auch, indem man Wähler darüber aufklärt, dass die vielen Steuersenkungen im AfD-Wahlprogramm ein Loch von über 154 Milliarden Euro in die Staatskasse reissen würde. Geld, das anderswo für wichtige Investitionen fehlt.
Zweitveröffentlichung
Tamedia-Kolumnen auf uniAKTUELL
Die Tamedia-Politkolumnen von Adrian Vatter und Rahel Freiburghaus sowie Markus Freitag erscheinen auch im Online-Magazin der Universität Bern uniAKTUELL.
Zum Institut für Politikwissenschaft (IPW) der Universität Bern
Das IPW ist eines der führenden politikwissenschaftlichen Institute der Schweiz. Es betreibt sowohl Grundlagenforschung als auch praxisrelevante Auftragsforschung. Deren Kernaussagen sind Bestandteil der angebotenen Studiengänge Bachelor «Sozialwissenschaften» und Master «Politikwissenschaft» sowie des schweizweit einzigartigen Studiengangs «Schweizer Politik im Vergleich». Schwerpunkte in Lehre und Forschung sind Politische Institutionen und Akteure, Europäische Politik, Klima, Umwelt und Energie, Öffentliche Meinung sowie Gender in Politik und Gesellschaft. Darüber hinaus bietet das IPW Dienstleistungen für die Öffentlichkeit an, wie zum Beispiel das Jahrbuch Schweizerische Politik (Année Politique Suisse).
uniAKTUELL-Newsletter abonnieren
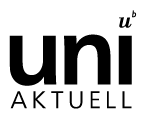
Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.