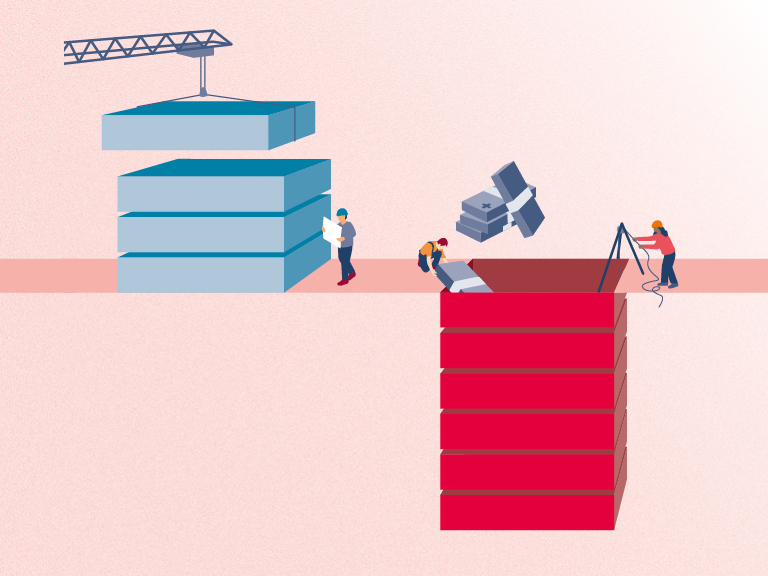Wirtschaftsinformatik
Die Softwarebranche setzt auf KI und New Work
Wie nutzen die Schweizer Softwareunternehmen KI oder neue Formen von Zusammenarbeit? Mayra Spizzo, Doktorandin am Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität Bern, leitet die grösste Umfrage in der Branche mit und kennt die Antwort.

In der Schweizer Softwareindustrie arbeiten drei Prozent der Erwerbstätigen, doch abgesehen davon weiss man im Detail wenig über die Branche. Der Swiss Software Industry Survey (SSIS) bringt seit 2015 Licht ins Dunkel und befragt dafür systematisch jedes Jahr rund 200 Unternehmen. Die Studie wird durch das Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität Bern geleitet, Forscherin Mayra Spizzo ist Co-Autorin der Umfrage.
Frau Spizzo, Sie untersuchen seit schon zum dritten Mal im Rahmen des SSIS die Schweizer Softwarebranche. Wie geht es der Branche heute und was hat sich im Laufe der letzten Jahre verändert?
Mayra Spizzo: Die Branche ist stabil, wobei ihr der KI-Boom zugutekommt. Allerdings hat sich das stetige Wachstum der letzten Jahre etwas abgeschwächt. Ebenso ist die Gewinnmarge 2024 von 9,1 auf 6,4 Prozent gesunken. Doch die Branche ist vital und äusserst vielfältig.
Die wichtigste Kundin der Softwareindustrie ist die öffentliche Hand. Sticht hier der Trumpf, dass sensible Daten nicht ins Ausland gelangen, wenn heimische Unternehmen zum Zuge kommen?
Die Datensicherheit ist für die öffentliche Hand ein zentraler Aspekt. Wenn Daten im Inland gelagert werden, ist das für viele Kundinnen und Kunden ein wichtiges Kriterium. Teilweise sieht die Ausschreibung dies sogar als zwingende Voraussetzung vor. Besonders die öffentliche Hand achtet häufig darauf, dass die Cloud im Inland gehostet wird. Viele Besteller legen ebenso Wert darauf, dass die Software im Inland entwickelt wird.
Nicht Datensicherheit, sondern die Arbeitswelt ist der Schwerpunkt des diesjährigen SSIS-Reports. Die IT-Industrie gilt als innovativ. Schlägt sich das auf den Arbeitsalltag nieder?
Die Auswertung unserer Befragung zeigt eindrücklich: Viele Unternehmen wenden Formen der «New Work» an: Die mitarbeiterorientierte Kultur reicht von einer hohen Selbstbestimmung über eine sinnhafte Arbeit bis zu flachen Hierarchien und einer familiären Atmosphäre. Der Führungsstil ist nicht autoritär, sondern kooperativ.
Beispielsweise haben über 80 Prozent der befragten Unternehmen die Atmosphäre in der Firma als familiär und persönlich beschrieben. Es werden enge Beziehungen gepflegt. Dagegen haben nur ein Drittel der Aussage zugestimmt, dass man auf eine koordinierende, organisierende und administrative Führung setze.
Haben Sie ein Beispiel dafür, wie Software-Unternehmen «New Work» anwenden?
Nehmen wir das Beispiel Homeoffice: Jede zweite befragte Firma gibt an, dass die Beschäftigten 50 Prozent oder mehr im Homeoffice arbeiten dürfen. Einschränkungen gibt es vor allem dann, wenn die jeweilige Funktion einen direkten Kundenkontakt verlangt – dann muss man natürlich vor Ort sein.
Über den Swiss Software Industry Survey (SSIS)
Die Softwarebranche ist ein zentraler Wachstumsmotor für hochentwickelte Volkswirtschaften wie die Schweiz. Dennoch wissen wir nur sehr wenig über die nationale Softwareindustrie. Der Swiss Software Industry Survey (SSIS) verfolgt das Ziel, diese Lücke zu schliessen. Der Swiss Software Industry Survey (SSIS) wird durch das Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität Bern durchgeführt und vom Swico und Dr. Sieber & Partners unterstützt. Geleitet wird der SSIS durch Prof. Dr. Jens Dibbern. Gleichzeitig löst der SSIS den bereits bekannten Swiss Software Industry Index (SSII) des Berner Beratungsunternehmens Dr. Pascal Sieber & Partners AG ab.
Gibt es auch Grenzen in dieser mitarbeitendenorientierten Firmenkultur?
Die Gestaltung des Lohns bleibt weiterhin in der Hand des Managements. Traditionell verhält sich die Branche auch bei der Bestimmung der Boni: Hier spielt der wirtschaftliche Erfolg des ganzen Unternehmens die wichtigste Rolle, gefolgt von der individuellen Leistung. Nur selten ist es die Leistung eines Teams, die gewürdigt wird. Wenn man weiss, wie häufig in der Software-Industrie in Teams gearbeitet wird, überrascht das. Wir werden diesem Widerspruch nachgehen.
Eine mitarbeitendenorientierte Firmenkultur hilft, Fachkräfte anzuziehen und zu halten. Wirkt sich selbstbestimmtes, sinnhaftes Arbeiten auch auf die wirtschaftliche Performance eines Unternehmens aus?
Tatsächlich gibt es diesen Zusammenhang. Software-Unternehmen, die verschiedene Arten von «New Work» fördern, haben angegeben, dass sie eine stärkere Zunahme der Unternehmensperformance verspüren. So haben wir eine Korrelation gesehen zwischen den Angaben der Unternehmen, verschiedene Arten von «New Work» zu fördern, und der verspürten Zunahme verschiedener Performance–Parametern wie Umsatzwachstum, Marktanteil, Gewinnwachstum, Investments und Mitarbeitenden- sowie Kundenzufriedenheit.
Viele haben noch das Bild im Kopf, wie die eine vermeintlich verstaubte Bundesverwaltung während der Covid-Pandemie Faxgeräte nutzte. Dennoch gilt die Schweiz laut dem Global Innovation Index als innovativstes Land der Welt. Gilt das auch für die Softwarebranche?
Der Innovationsindex nutzt als einen wichtigen Indikator die Zahl der angemeldeten Patente. Doch im untersuchten Segment sind Patente weniger wichtig. Indirekt trägt die Software selbstverständlich zur Innovation bei, da sie integraler Bestandteil vieler neuer Produkte und Dienstleistungen ist. Entsprechend lässt sich behaupten, dass die Software-Industrie zu diesem Innovations-Spitzenplatz der Schweiz beiträgt.
Heute spricht alles nur noch von KI. Wie weit nutzt die Softwarebranche diese Technologie?
Im letzten SSIS-Report war KI unser Schwerpunkt. Aufgrund der Aktualität haben wir dieses Jahr einige Punkte nochmals nachgefragt. Tatsächlich steigt der Einsatz von KI im ganzen Lebenszyklus der Softwareentwicklung rasant. Das zeigt schon die Tatsache, dass 81,4 Prozent der befragten Software-Unternehmen KI in der Entwicklung von Software nutzen – im Vergleichsjahr 2024 waren es erst 46,8 Prozent.
Können Sie ein Anwendungsbeispiel nennen?
Meine eigene Dissertation. Sie untersucht, ob KI bei der Notfallmedizin den menschlichen Diagnoseprozess unterstützen und so verbessern kann. Natürlich braucht es weiterhin den Menschen, auch ethisch und rechtlich wäre es nicht zulässig, ganz auf KI zu setzen. Aber solche Anwendungen zeigen, dass generative KI, die auf Unmengen vorhandener Daten aufbaut, einen praktischen Nutzen im Alltag bringen kann.

Die Branche wächst aktuell kaum mehr. Bleibt sie trotzdem attraktiv?
Der Schweizer Softwarebranche geht es immer noch gut, und wir erwarten in den nächsten Jahren wieder ein verstärktes Wachstum. Der Fachkräftemangel und die hohe Mobilität der IT-Fachkräfte führt zu einer traditionell hohen Fluktuation. Daher sehe ich die Softwarebranche weiterhin als attraktive Branche für Studierende.
Wieso haben Sie sich für ein Studium in Betriebswirtschaftslehre entschieden?
Als ich die Besuchstage unterschiedlicher Universitäten besuchte und mich zu verschiedenen Studiengängen informierte, überzeugte mich das Angebot der Universität Bern: Die Breite der Themen im Studiengang stimmten mit meinem breiten Interesse überein. Vor allem die Themen aus den Bereichen Wirtschaftsinformatik und Konsumentenverhalten hatten meine Neugierde geweckt. Zudem sagten mir die Kombinationsmöglichkeit mit verschiedenen Minor-Angeboten, wie dem Minor nachhaltigen Entwicklung, und die vielfältigen Berufsmöglichkeiten nach dem Studium zu.
Basis für die Entwicklung von Softwareinnovationen ist eine fundierte Aus- und Weiterbildung. Was tragen die Universitäten dazu bei?
Tatsächlich entstehen generell viele Innovationen an den Universitäten. Mir scheint, dass sich gerade die Universität Bern bemüht, ihre Programme an die schnelle Entwicklung anzupassen. Vor Kurzem lancierte sie beispielsweise den neuen Master «Statistik und Data Science» und das neue Minorstudienprogramm «Digitalization and Applied Data Science in Business, Economics and the Social Sciences». Der Bachelor Minor vermittelt einerseits ein grundlegendes Verständnis für die digitale Transformation von Unternehmen, Volkswirtschaften und Gesellschaften. Anderseits lernt man, grosse Datenmengen zu sammeln, zu organisieren, zu visualisieren und zu analysieren. Schliesslich arbeiten etliche Studierende schon während ihrer Zeit an der Uni in der Privatwirtschaft und erhalten so Impulse aus der Unternehmenspraxis.
Zur Person

Mayra Spizzo
ist Doktorandin am Institut für Wirtschaftsinformatik (IWI) der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern. Sie forscht zum Thema Mensch-KI–Interaktion bei Entscheidungsfindungsprozessen.
Über das Institut für Wirtschaftsinformatik
Das Institut für Wirtschaftsinformatik (IWI) bildet künftige Führungskräfte darin aus, das Potenzial von Informationstechnik in Organisationen zu nutzen. In Forschung und Lehre verbindet es technologische Trends wie soziale Medien, Big Data, Cloud Computing und Software-Ökosysteme mit Kernthemen der Wirtschaftsinformatik wie E-Business, globale IT-Beschaffung, Prozessmanagement und Wissensmanagement. Das Departement nutzt innovative Lehrmethoden und publizieren unsere Forschung in führenden Fachzeitschriften.
uniAKTUELL-Newsletter abonnieren
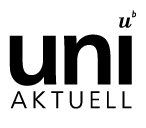
Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.