UniBE talks
Zum Stand der Forschungszusammenarbeit mit den USA
Die neue US-Forschungspolitik trifft auch Forschende der Universität Bern unmittelbar. Dies zeigte sich an der Veranstaltung «UniBE talks» zum Thema «Research Collaborations with the USA». Der Austausch mit amerikanischen Kolleginnen und Kollegen bleibt wichtig.

«UniBE talks» nennt sich das Veranstaltungsformat der Universität Bern, das am 1. Mai im gut gefüllten Audimax stattfand. Ziel der Gesprächs- und Diskussionsrunde, die künftig einmal pro Semester stattfinden soll, sei nicht zuletzt das «Community Building», erklärte Rektorin Virginia Richter in ihrer Einleitung. Das Zusammenstehen als Wissenschaftsgemeinschaft sei heute so wichtig wie selten zuvor, nur gemeinsam und solidarisch lasse sich die nötige Resilienz aufbauen, um den «lange nicht gekannten Unsicherheiten in der akademischen Welt» zu begegnen. Mit Blick auf die Agenda der Trump-Regierung forderte Richter, die Disziplinen dürften sich nicht gegeneinander ausspielen lassen: «Theoretische Physikerinnen und Physiker müssen Solidarität zeigen mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus der Klimaphysik.»
Budgetkürzungen in Milliardenhöhe und Stellenabbau
Informationen aus erster Hand über die unübersichtliche Lage in den USA lieferte zu Beginn der Veranstaltung Brendan Karch, der via Zoom zugeschaltet war. Er ist der interimistische Leiter von Swissnex in Boston, einem der Aussenposten der Schweiz zur Vernetzung mit der internationalen Forschungs- und Innovationslandschaft. Karch erläuterte bereits erfolgte und für die Zukunft geplante Budgetkürzungen in Milliardenhöhe und sprach vom Stellenabbau bei den Förderinstitutionen wie dem Amerikanischen Nationalfonds – alles in allem ein düsteres Bild.

Doch der Swissnex-Vertreter gab auch Entwarnung: Von den viel diskutierten Visa- und Einreiseproblemen seien ihm für Schweizer Forschende bis anhin nur zwei Fälle bekannt. Und für die Zukunft gab sich Brendan Karch gedämpft optimistisch: «Die Schweiz bleibt eine starke Partnerin der USA.» Seine Gespräche mit Forschungsinstitutionen und Fördereinrichtungen hätten gezeigt, dass Partnerschaften mit Forschenden aus der Schweiz nach wie vor gefragt seien.
Eine Atmosphäre der Angst und düstere Jobaussichten
In der anschliessenden Podiumsdiskussion, die von der Amerikakennerin Claudia Franziska Brühwiler von der Universität St. Gallen geleitet wurde, berichteten vier Forschende der Universität Bern von ihren persönlichen Erfahrungen mit der neuen US-Forschungspolitik: die Politikwissenschaftlerin Karin Ingold, die Evolutionsbiologin Catherine Peichel, der Klimaforscher Thomas Frölicher und der Gesundheitswissenschaftler Per von Groote.
«Ich war überrascht, wie deprimiert ich meine Kolleginnen und Kollegen aus den USA angetroffen habe.»
Karin Ingold
Karin Ingold, die auch Präsidentin des Oeschger-Zentrums für Klimaforschung an der Universität Bern ist, erzählte von einem kürzlichen Arbeitsbesuch an der University of Colorado. Sie sei überrascht gewesen, wie deprimiert sie ihre Kolleginnen und Kollegen angetroffen habe, und schockiert über die «Atmosphäre der Angst». Als besonders bedrückend empfand sie die Situation von Doktorierenden in Klima- und Umweltwissenschaften, die sich grosse Sorgen um ihre berufliche Zukunft machten. Zurück in Bern habe sich eine der amerikanischen Kolleginnen bei ihr gemeldet und gefragt, ob es in der Schweiz wohl eine Stelle für sie gäbe: «Ich habe mit meiner Familie gesprochen, wir sind bereit auszuwandern.»
Gefährdete Messdaten für Klimamodelle
Alle auf dem Podium versammelten Berner Forschenden haben Projekte, die zum Teil aus den USA finanziert werden, und sie sahen sich auch bereits alle mit Budgetkürzungen konfrontiert.

Für Thomas Frölicher allerdings gehen die Schwierigkeiten noch weiter. Er arbeitet mit Ozean-Messdaten, die in den Weltmeeren mit einem mobilen Beobachtungssystem namens Argo erhoben werden. Finanziert ist dieses internationale Programm zur Hälfte über staatliche Mittel aus den USA. Könnten die 1500 schwimmenden Messroboter nur noch teilweise weiterbetrieben werden, weil die amerikanischen Mittel ausbleiben, so Frölicher, drohten «blinde Flecken» bei der globalen Datenerhebung – mit entsprechenden Konsequenzen für die Vorhersagen von Klimamodellen.
Noch mehr als die Sorge über die Zukunft von Messdaten, auf die er und andere Schweizer Forschende angewiesen sind, belasten Frölicher die gefährdeten persönlichen Kontakte. «Ich hätte in nächster Zeit US-Kollegen und -Kolleginnen an Konferenzen in Europa treffen sollen – das ist nicht mehr möglich. Sie dürfen alle nicht mehr reisen.»

Plötzlicher Mittelstopp trifft Aids-Forschung hart
Am stärksten von US-amerikanischen Budgetkürzungen betroffen ist an der Universität Bern wohl Per von Groote. Er ist Programmmanager von IeDEA, einer internationalen epidemiologischen Datenbank zur Verbreitung von AIDS in Afrika. Zusammen mit Partnern an der Universität Kapstadt erforscht das Berner Team, wie Menschen mit dem HI-Virus ein langes und möglichst gesundes Leben führen können. Im Rahmen dieser Projekte wurden in Bern 14 Mitarbeitende durch Mittel des US National Institute of Health finanziert. Doch Anfang dieses Jahres war damit nach 19 Jahren von einem Tag auf den anderen Schluss. Der Grund: AIDS ist in den USA – ähnlich wie das Klima – kein opportunes Forschungsgebiet mehr. «Wir realisierten, dass etwas nicht mehr rund läuft», berichtete von Groote, «als wir plötzlich nicht mehr auf unsere Konten in den USA zugreifen konnten, um Löhne zu bezahlen.»
Sollen sich junge Forschende noch in den USA bewerben?
Wie weiter also bei der von Ungewissheit geprägten Forschungszusammenarbeit? Und: Sollten sich Nachwuchsforschende überhaupt noch um Postdoc-Stellen in den USA bewerben? Klare Antworten auf solche Fragen, die zurzeit viele Berner Forschende umtreibt, gibt es nicht, wie sich bei der Podiumsdiskussion zeigte. «Es kommt stark auf das Forschungsgebiet an, in den Klimawissenschaften wäre ich sehr vorsichtig», meinte Brendan Karch von Swissnex. In anderen Bereichen könne ein Forschungsaufenthalt in den USA immer noch ein «sehr bereicherndes Erlebnis» sein. Allerdings sollte man sich ein genaues Bild davon machen, wie es in der Forschungsgruppe, in der man arbeiten möchte, mit der Finanzierung stehe.
«Wir sollten globaler denken und unsere Netzwerke vermehrt nach Asien und in den globalen Süden ausrichten.»
Catherine Peichel
Ausgerechnet Per von Groote, der die Folgen der US-Budgetkürzungen besonders drastisch erlebt, gab sich in der Diskussion optimistisch. Er empfahl zwar, sich bei der Finanzierung von Forschungsprojekten breiter aufzustellen und nach alternativen Finanzquellen Ausschau zu halten, doch umgekehrt meinte er: «Wir sollten unbedingt weiterhin in die Forschungszusammenarbeit mit den USA investieren.»

Forschungsnetzwerke neu denken – globaler und breiter
Catherine Peichel, selbst Amerikanerin, die 2016 an die Universität Bern kam, skizzierte ein differenziertes Bild der neuen Realitäten: Einerseits empfahl sie, sich von der Vorstellung zu lösen, die USA seien der Nabel der Forschungswelt. «Wir sollten globaler denken und unsere Netzwerke vermehrt nach Asien und in den globalen Süden ausrichten.» Andererseits aber warnte die Evolutionsbiologin davor, langjährige Partnerschaften aufzugeben. «Ich möchte nicht, dass meine US-Kolleginnen und -Kollegen das Gefühl erhalten, sie würden von der internationalen Forschungscommunity im Stich gelassen.»
UniBE talks
«UniBE talks» ist eine Veranstaltungsreihe der Universität Bern, die den Dialog zu unterschiedlichen wissenschaftsrelevanten Themen zum Ziel hat. Die Veranstaltungen sollen jeweils eine möglichst grosse Vielfalt der Disziplinen und Wissenschaftskulturen an der Universität Bern repräsentieren. Die Universität möchte mit «UniBE talks» den Austausch zwischen Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher Wissenschaftskulturen fördern.
uniAKTUELL-Newsletter abonnieren
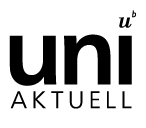
Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.


