Wissenschaft
Gute Forschung ist reproduzierbar und bringt uns weiter
Wie funktioniert Wissenschaft? Im Gespräch diskutieren Angelika Kalt, seit 2016 Direktorin des Schweizerischen Nationalfonds, und Hugues Abriel, seit 2022 Vizerektor Forschung der Universität Bern, über gute Forschung, den Einfluss der Politik und die Verantwortung der Forschenden.

Angelika Kalt: Ich bin ja eigentlich seit 2009 keine Wissenschaftlerin mehr. Aber was mich einst zur Wissenschaft gebracht hat, waren Neugier und ein grosser Wissensdrang. Es war für mich auch immer klar, dass ich etwas Naturwissenschaftliches machen wollte. Ich habe mich dann für Geologie entschieden, weil mich dort, neben den naturwissenschaftlichen Aspekten, vor allem die Ästhetik angezogen hat. Ich konnte mich dabei mit schönen Objekten in allen Massstäben – vom Gebirgsrücken über den einzelnen Stein mit seinen Mineralien bis zum Dünnschliff und der atomaren Struktur – beschäftigen. Und meine wissenschaftliche Karriere ging irgendwie immer weiter und wurde immer interessanter: Nach der Schule kam die Universität und dann eine Dissertation.
Hugues Abriel: Zuerst war auch bei mir die Neugierde da – das muss einfach so sein, damit jemand eine wissenschaftliche Karriere machen kann. Ich war eigentlich immer fokussiert auf den menschlichen Körper, auf Pharmakologie, Medizin und Biologie. Für mich war der Drang, zu verstehen, wie wir als Menschen funktionieren, immer die Hauptmotivation. Für mich war es jedoch nicht so normal, dass ich an einer Universität landete. Ich komme aus einer Familie, in der zuvor niemand an einer Uni gewesen war. Aber ich habe früh gemerkt, dass ich von unserem Bildungssystem profitieren und etwas lernen kann, das mir Spass macht und mir Möglichkeiten eröffnet.
Haben sich Forschung und Wissenschaft und Ihre Sicht darauf im Laufe Ihrer Karriere verändert?Kalt: Ich glaube, wenn man so wie ich auf einer «Schiene» in das Wissenschaftssystem hineingerät, dann ist man eine ganze Weile erstmals darin und macht alles mit. Irgendwann entwickelt man aber einen Abstand. Und dabei habe ich dann zwei Dinge beobachtet: einerseits die Entwicklung hin zum Spezialistentum – alle Forschenden haben quasi ihre eigene Nische, und jeder ist der beste Experte für sich selbst. Andererseits habe ich angefangen, die alten Strukturen an den Hochschulen zu hinterfragen: Alle arbeiten auf eine Professur hin, und dieser Weg ist heute einfach nicht mehr attraktiv genug. Man ist viele Jahre abhängig von jemanden.
Abriel: Ja, der Arbeitsaufwand ist enorm und hat in den letzten 20 Jahren noch deutlich zugenommen. Die Wissenschaft ist insgesamt viel kompetitiver geworden. Und trotzdem sind die Regeln, wie man für eine Professur selektioniert wird oder wie Grants vergeben werden, immer noch nicht überall transparent. Aber es gibt positive Entwicklungen. So weiss man beim SNF heute, wer in den Gremien sitzt und welche Regeln bei einer Vergabe gelten, das war nicht immer so. Und es gibt Open Science, bei der man die Forschungsdaten freier verfügbar macht, oder die interdisziplinäre Zusammenarbeit, die heute fast Normalität geworden ist. Zudem hat sich der Stellenwert der Forschung aus meiner Sicht grundsätzlich erhöht.
Sie haben die Karrierewege angesprochen und auch die zum Teil noch fehlende Transparenz in Bezug auf die Kriterien bei der Besetzung von Professuren. Wo sehen Sie hier den grössten Handlungsbedarf?Kalt: Es gibt bei der Besetzung von Professuren leider immer noch die Kultur, dass man anhand der Anzahl Publikationen ableitet, ob eine Person genügend qualifiziert ist. Der Publikationsdruck ist deshalb hoch. Der SNF und viele Hochschulen wollen das ändern. Sie haben dafür die DORA-Deklaration unterschrieben. Beim SNF versuchen wir es zum Beispiel mit einer neuen Art von CV, die wir von den Forschenden verlangen, wenn sie einen Antrag stellen. Darin kann man nicht mehr ganze Publikationslisten anheften, sondern muss die wichtigsten Errungenschaften präsentieren. Das Ziel wäre dann, dass man nur auf dieser Basis beurteilt wird.
Abriel: Es ist hier in Bern unser Ziel und meine Aufgabe, die DORA-Deklaration umzusetzen. Das ist harte Arbeit. Es gibt Widerstand, weil gewisse Leute vor allem aus der älteren Generation den Mehrwert einfach nicht verstehen. Die Jüngeren sehen das meist anders.
Wissenschaftsförderung
Der Schweizerische Nationalfonds (SNF)
Der Schweizerische Nationalfonds (SNF) fördert im Auftrag des Bundes die Forschung in allen wissenschaftlichen Disziplinen – von der Physik über die Medizin bis zur Soziologie. Ende 2021 finanzierte er mit 882 Millionen Franken 5700 Projekte mit über 20 000 beteiligten Forschenden. Er ist damit die wichtigste Schweizer Institution zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. In enger Zusammenarbeit mit Hochschulen und weiteren Partnern setzt sich der SNF dafür ein, dass sich die Forschung unter besten Bedingungen entwickeln und international vernetzen kann. Besondere Aufmerksamkeit schenkt der SNF dabei der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Zudem übernimmt er im Rahmen von Evaluationsmandaten die wissenschaftliche Qualitätskontrolle von grossen Schweizer Forschungsinitiativen, die er nicht selbst finanziert. (Quelle: www.snf.ch)
Gibt es denn diesen Publikationsdruck überall, oder ist er eine Ausprägung der westlichen Universitäten? Und wer legt solche Regeln fest?
Abriel: Am Ende entwickeln die internationalen Fachcommunitys diese Regeln. Das System ist sehr von den westlichen Universitäten geprägt. Ich sehe zum Beispiel bei meinen afrikanischen Kollegen, dass sie dieses System einfach übernehmen, weil sie das Gefühl haben, so sei es gut. Dabei gäbe es natürlich viele Alternativen beim Publizieren oder wie man an einer Universität eine Selektion machen kann.
Kalt: Ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen Qualitätsstandards im Allgemeinen und dem Publikationsbusiness. Die Qualitätsstandards im Allgemeinen werden in den Fachcommunitys entwickelt. Es stimmt, dass diese von den forschungsstarken Ländern geprägt sind. Das Publikationsbusiness orientiert sich an diesen Qualitätskriterien, hängt aber stark von den einzelnen Verlagen und deren Politik ab. Da gibt es eben grosse Unterschiede zwischen guten und schlechten Journals.
Und welchen Einfluss hat die Globalisierung? Ist man heute in einem stärkeren Austausch als vor 30 Jahren, und haben sich dadurch die Qualitätsstandards verändert?Kalt: Forschung war schon immer sehr international. Ich glaube nicht, dass sich die Forschung durch die Globalisierung fundamental verändert hat. Aber es gibt einige wenige wissenschaftliche Erkenntnisse, die darauf hindeuten, dass wir Probleme schneller lösen können, wenn Leute aus unterschiedlichen Kulturen zusammenarbeiten.
Abriel: Man merkt aber auch, dass trotz Globalisierung das Know-how aus nicht westlichen Ländern manchmal nur schwer zu uns gelangt. Bei Krankheiten wie Affenpocken oder Ebola haben wir in den afrikanischen Ländern grosse Expertise, wie man sie behandeln könnte. Für die Kollegen in Afrika ist es aber extrem schwierig, ihre Erkenntnisse zu zeigen, einerseits, weil sie vom Westen immer noch von oben herab behandelt werden, andererseits aus ganz praktischen Gründen. Sie kriegen zum Beispiel keine Visa oder haben kein Geld für die Teilnahme an einer Konferenz in Europa oder in den USA. Ich glaube, man könnte viel mehr tun, um die Wissenschaft inklusiver zu machen.
Kalt: Das kann man auf jeden Fall, und wir gehen beim Nationalfonds diesen Weg, indem wir zum Beispiel Abkommen mit anderen Förderorganisationen in Afrika und Südamerika schliessen. Die internationale Zusammenarbeit ist in erster Linie dazu gedacht, dass man die Wissenschaft diversifiziert und dass man mit allen Spezialisten an einem Problem arbeiten kann. Darüber hinaus kann die internationale Zusammenarbeit auch politische bzw. diplomatische Hintergründe haben.
Wie meinen Sie das?Kalt: Einerseits kann die internationale Forschungszusammenarbeit Türen öffnen, die aufgrund von politischen Spannungen eigentlich verschlossen sind. Andererseits beobachtet man derzeit weltweit wieder einen gewissen Protektionismus – weil sich geopolitische Fronten aufbauen. In diesem Zusammenhang will man nicht, dass Informationen und Wissen, zum Beispiel über neue Methoden und Technologien, an Stellen weitergegeben werden, die nicht zum politischen Freundeskreis gehören.
Ist dieser neue Protektionismus ein Problem?Kalt: Die Frage ist, was Priorität hat – die freie Forschung, die über alle Grenzen hinweg Ergebnisse austauschen kann, oder die Sicherheit eines Staates? Es gibt grosse Diskussionen über den sogenannten Dual Use, also die Tatsache, dass man wissenschaftliche Ergebnisse und Erfindungen auch für Kriegszwecke gebrauchen kann. Das Problem ist nicht einfach zu lösen; die Dinge sind teilweise nicht klar geregelt. Sie unterliegen sehr häufig dem Verantwortungsbereich der Forschenden.

Abriel: Für viele Bereiche gibt es natürlich schon Regeln, insbesondere in Bezug auf Ethik und wissenschaftliche Integrität. Aber die Dual-Use-Problematik werden wir noch besser regeln müssen. Ein Beispiel, um die Problematik zu zeigen: die Gefahr von Dual Use of Artifical Intelligence to Drug Discovery. Mit künstlicher Intelligenz kann man sehr schnell extrem toxische Substanzen erstellen – innerhalb von sechs Stunden können 40 000 toxische Moleküle erfunden werden. Diese Technologie kann natürlich missbraucht werden.
Wie legt man denn die Grenzen der Forschung fest?Kalt: Es ist ein Zusammenspiel verschiedener Einflüsse aus der wissenschaftlichen Community und endet oft in einem Gesetz, einer Verordnung oder einer Bestimmung. Zudem baut Wissenschaft immer auf Bestehendem auf. Wenn Sie ein Forschungsprojekt lancieren möchten, orientieren Sie sich an bereits getätigter Forschung. Da wird meistens klar, was als ethisch vertretbar gilt und was nicht.
Abriel: Junge Forschende sind oft sehr ambitiös und haben diese grosse Neugier. Wenn sie dann aber Anträge schreiben müssen, sehen sie, dass das System zum Beispiel Bewilligungen für Tierversuche verlangt oder dass man klar formulieren muss, wofür man das Geld einsetzen will. Wir haben hier ja auch eine Verantwortung in Bezug auf den Umgang mit Steuergeldern. Die Rolle der Universität und der Institutionen ist es, eine Umgebung zu schaffen, in der die Forschenden Verantwortung lernen und übernehmen können.
Kann man gute Forschung definieren?Kalt: Der Begriff der Exzellenz steht schon im Gesetz über die Förderung der Forschung und der Innovation, und diesen Begriff haben wir beim SNF weiter definiert. Gute Forschung ist die, die uns einen möglichst grossen Schritt weiterbringt – aber nicht um jeden Preis. Die Frage muss originell, aber auch relevant sein. Das heisst, der Fortschritt, der erzielt werden kann, muss im jeweiligen Forschungsfeld bedeutend sein. Dann geht es auch darum, welche Methoden man anwendet. Man muss gründlich sein, die Methoden müssen nachhaltig sein, und man muss seine Arbeit nachvollziehbar machen, sodass die Ergebnisse reproduzierbar sind.
Abriel: Ich bin einverstanden, dass man gute Forschung so definieren kann. Für mich ist es jedoch schwierig, zu sagen, ein Ergebnis sei zu «klein». Sehr oft sind bei uns die Ergebnisse inkrementell – es geht also in ganz kleinen Schritten vorwärts. Solche Forschung ist für mich ebenfalls gute Forschung. Für mich zentral ist die Reproduzierbarkeit. Wenn ich weiss, dass ich ein Resultat aus unserem Schweizer Labor auch in einem Labor in Tokio erhalte, ist das gute Forschung. Diese Resultate sind robust.
Abriel: Den Begriff «scheitern» müsste man noch genauer definieren. Wir scheitern sehr oft im Labor, in dem Sinn, dass wir negative Resultate haben. Wir haben eine Hypothese, testen diese an zwei, drei Komponenten und stellen fest, dass die Resultate im Labor die Hypothese nicht unterstützen. Das heisst aber noch nicht, dass sie falsch ist. Für uns ist das deshalb kein Scheitern, sondern einfach ein negatives Resultat. Wir haben damit aber insofern ein Problem, als wir viel Zeit und Geld investiert haben, um dieses negative Resultat zu kriegen, und es fast unmöglich ist, dieses zu publizieren. So wissen die Kollegen nicht, dass sie diese Versuche nicht machen müssten.
Kalt: Und dann werden erneut öffentliche Mittel ausgegeben, um dasselbe zu untersuchen. Das ist ein echtes Problem – man nennt dies «Publikationsbias», weil viel mehr Studien mit positiven Resultaten publiziert werden. Der SNF unterstützt deshalb das Swiss Reproducibility Network.
Aktuell gibt es in den Medien viele Diskussionen über Fake News und auch über Pseudoforschung: Beschäftigen solche Vorurteile die Forschenden?Kalt: Es ist wohl kein Problem für die Forschenden, aber für die Bevölkerung. Wie können sie noch unterscheiden, was aus einer vertrauenswürdigen und professionellen Quelle kommt und was nicht? Da denke ich schon, dass die öffentlichen Einrichtungen wie der SNF und auch die Hochschulen noch mehr machen könnten. Ich denke etwa an Beratungsstellen, wo die Leute einfach fragen könnten: Stimmt das oder stimmt das nicht? In die Wissenschaftskommunikation zu investieren, fände ich eine sehr gute Investition.
Welchen Stellenwert hat Wissenschaft in der Schweiz denn heute?Abriel: Es gibt eine aktuelle Befragung: Wie hoch ist Ihr Vertrauen in die Wissenschaft? Sie zeigt, dass das Vertrauen sehr hoch ist. Interessant fand ich, dass die jüngere Generation noch mehr Vertrauen hat als die ältere – das hätte ich nicht gedacht.
Kalt: Vielleicht hängt das positive Bild der Wissenschaft damit zusammen, dass viele wissen, dass die «graue Masse» der Rohstoff der Schweiz ist. Und dass es eben ohne kluge Köpfe und neue Ideen keinen Fortschritt geben kann. Wissenschaft ist der Ursprung von vielem – es gibt nichts Neues ohne Wissenschaft, keine Antworten auf wichtige Fragen, keine Start-ups, keine Fachkräfte – der ganze Wirtschaftszyklus der Schweiz hängt sehr stark von der Wissenschaft ab.
Leistungsbeurteilung
DORA-Deklaration
Lange Zeit galt die Zitierungsrate einer Zeitschrift, der Journal Impact Factor, als wichtigstes Kriterium für die Leistungsbeurteilung einzelner Forschenden. Nur sagt dieser nichts über die persönliche Leistung oder die Qualität eines Artikels aus. Deshalb empfiehlt die DORA-Deklaration eine umfassendere Bewertung. In die Bewertung sollen nicht nur publikationsbezogene Faktoren, sondern auch Drittmitteleinwerbung, Betreuung von Nachwuchsforschenden, Leistungen in der Lehre, Innovationspotenzial, Transferleistungen, wissenschaftliche Integrität, Open Access oder soziale Fähigkeiten einfliessen. Die DORA-Deklaration macht folgende Empfehlungen: – Verwenden Sie keine journalbasierten Metriken, wie den Journal Impact Factor, als Ersatz für die Bewertung der Qualität einzelner Forschungsartikel, um die Beiträge einzelner Wissenschaftler zu bewerten oder um Entscheidungen über Einstellung, Beförderung oder Finanzierung zu treffen. – Stellen Sie klar, welche Kriterien Sie für Entscheidungen über Einstellungen und Beförderungen benutzen, und betonen Sie, besonders gegenüber Wissenschaftlern am Beginn ihrer Karriere, dass der wissenschaftliche Inhalt eines Artikels wichtiger ist als die Publikationsmetrik oder das Journal, in dem er veröffentlicht wurde. – Berücksichtigen Sie für die Forschungsbewertung neben Publikationen auch alle anderen Forschungsleistungen (einschliesslich Datensätzen und Software). Die Universität Bern hat die DORA-Deklaration unterzeichnet und setzt diese seit 2016 um. (Quelle: www.unibe.ch)
Sie denken also, die Bevölkerung versteht die Bedeutung der Wissenschaft für den Standort Schweiz. Wie steht es denn um die Politik?
Kalt: Die hiesige Politik versteht es ebenfalls sehr gut. Die Ausgaben für Bildung und Forschung sind in der Schweiz im Vergleich zu Europa überdurchschnittlich. Es gibt natürlich Länder, die noch mehr investieren, Israel zum Beispiel. Aber die kann man an einer Hand abzählen. Ich glaube, es herrscht ein allgemeines Bewusstsein darüber, dass Bildung, Forschung und eine gut ausgebildete Bevölkerung der Motor für einen sehr innovativen Tertiärsektor ist.
Abriel: Die Politik versteht natürlich, dass es Innovation im Allgemeinen braucht. Aber sie will meist die direkte Anwendbarkeit der Forschung sehen. Das Verständnis, wie wichtig Grundlagenforschung ist, ist nicht bei allen Politikerinnen und Politikern vorhanden. Wir müssen immer wieder betonen, dass es die angewandte Forschung ohne Grundlagenforschung nicht gibt.
Kalt: Es ist auch schwierig, zu erklären, wie die Forschung funktioniert. Zwischen einer grundlegenden Entdeckung und ihrer Anwendung vergehen häufig Jahrzehnte. Diese zeitliche Dimension ist etwas, was noch nicht so gut verstanden wird. Viele denken, dass Forschung kurzfristig zu Durchbrüchen, Erfolgen, Produkten oder Services führen sollte.
Wie gross ist der Einfluss der Politik auf die Wissenschaft in der Schweiz? Kann die Wissenschaft an der Universität unabhängig und frei arbeiten?Abriel: Die Freiheit ist schon sehr gross, und die Universitäten haben in der Vergangenheit etwas mehr Autonomie erhalten. Aber es gibt im Parlament natürlich immer mal wieder Petitionen, etwa zu den Tierversuchen, bei denen die Politik auch Einfluss auf die Forschungsmethoden nehmen will. Aber das gab es schon immer. Ich glaube nicht, dass dies zunehmend ist.
Kalt: Die Hochschulen entscheiden selbst, welche Professuren sie ausschreiben wollen, und die Wissenschaftler entscheiden selbst, was sie erforschen wollen und mit welchen Methoden. Die Forschungsfreiheit ist also relativ gross. Wenn man den Nationalfonds anschaut, ist ein sehr grosser Teil unseres Budgets der freien Forschung vorbehalten, wo alle ihre Themen und Methoden selbst wählen können. Es gibt aber auch Themenbereiche, für die der Bund Mittel festlegt, zum Beispiel bei den nationalen Forschungsprogrammen. Aber auch das ist noch lange keine Auftragsforschung, es wird einfach Geld für bestimmte Themen reserviert.
Wo sehen Sie noch Verbesserungsmöglichkeiten für die Forschung?Kalt: Die Modernisierung der akademischen Karriere wäre für mich ein wichtiger Punkt. Man muss sich überlegen, wie man die akademische Karriere attraktiv halten kann. Ich sage nicht, dass jeder und jede eine Dauerstelle erhalten muss; das geht nicht, die Hochschule lebt vom Wandel. Aber man muss sich schon überlegen, wie das System kompatibler wird mit dem, was man sonst auf dem Arbeitsmarkt findet. Wenn man nach der Dissertation in eine Firma geht, bekommt man eine verantwortungsvolle Position oder ein eigenes Projekt. Wenn man an der Uni weiter eine Postdocstelle hat, bleibt man noch etliche Jahre abhängig. Man muss den Doktorierenden zudem klar sagen, dass es nicht zweite Wahl ist, in die Wirtschaft zu gehen.
Abriel: Im Gegenteil: Es ist unser Auftrag, Leute für die Wirtschaft auszubilden. Es ist extrem wichtig, dass das auch nach dem Doktorat weitergeht. Als Uni müssen wir etwas unternehmen, damit wir attraktiv bleiben. Dafür müssen wir auch über Strukturen und Regeln reden. Es muss Möglichkeiten geben, auch langfristige Stellen zu bekommen. Für mich sind die Implementierung von DORA und die Internationalisierung sehr wichtig. Wir müssen wegkommen von dieser metrischen Betrachtung und die Ansichten und Ideen anderer Länder und Kulturen mehr inkludieren, um die Qualität der Forschung weiter zu verbessern.
Über Hugues Abriel

Prof. Dr. Hugues Abriel wechselte 2009 von der Universität Lausanne an die Universität Bern und ist seit 2016 ordentlicher Professor für Molekulare Medizin. Er ist derzeit Direktor des NCCR TransCure und fungiert seit 2022 zudem als Vizerektor Forschung.
Über Angelika Kalt

Dr. Angelika Kalt war während acht Jahren ordentliche Professorin für Petrologie und interne Geodynamik an der Universität Neuenburg. Sie ist seit 2008 beim SNF tätig und seit 2016 dessen Direktorin.
Neues Magazin uniFOKUS
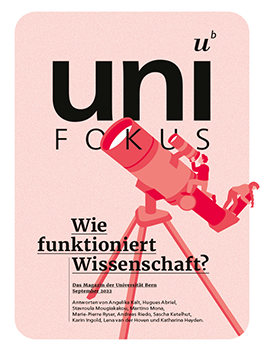
Jetzt gratis abonnieren!
Dieser Artikel erschien erstmals in uniFOKUS, dem neuen Printmagazin der Universität Bern. uniFOKUS zeigt viermal pro Jahr, was Wissenschaft zu leisten vermag. Jede Ausgabe fokussiert aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf einen thematischen Schwerpunkt und will so möglichst viel an Expertise und Forschungsergebnissen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Bern zusammenführen.
Das Online-Magazin der Universität Bern

uniAKTUELL als Newsletter abonnieren
Die Universität Bern betreibt Spitzenforschung zu Themen, die uns als Gesellschaft beschäftigen und unsere Zukunft prägen. Im uniAKTUELL zeigen wir ausgewählte Beispiele und stellen Ihnen die Menschen dahinter vor – packend, multimedial und kostenlos.