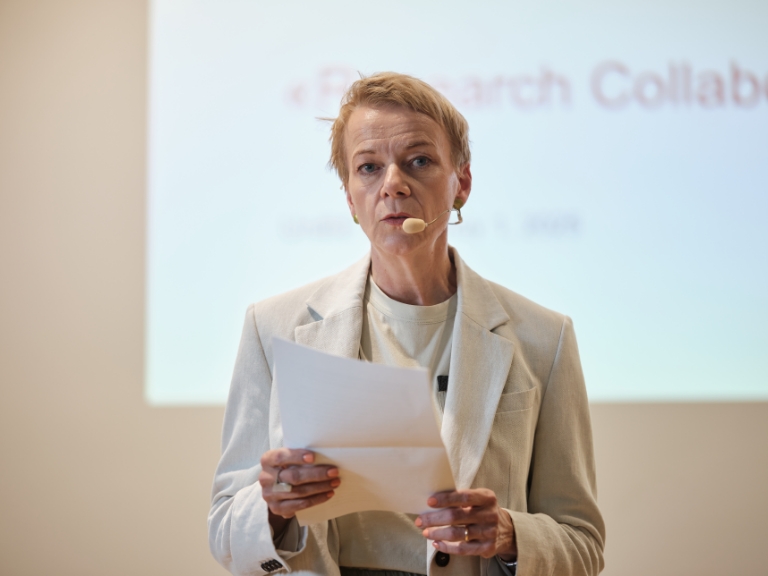Universität
«Wenn wir jetzt nicht sparen, werden die Herausforderungen nur grösser»
Rektorin Virginia Richter spricht über die finanziellen Herausforderungen der Universität Bern und die ab 2026 geplanten Sparmassnahmen.

Virginia Richter: Der Kanton Bern ist Träger der Universität und finanziert die Grundkosten für Forschung und Lehre – dies macht rund ein Drittel unseres Budgets aus. Dann erhält die Universität Mittel vom Bund und sogenannte IUV-Beiträge. Diese Beiträge der Interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV) sind die Abgeltung durch die Kantone für die Ausbildung ihrer Studierenden in anderen Kantonen. Eine weitere wichtige Quelle sind die sogenannten Drittmittel, die knapp 40 Prozent unseres Gesamtbudgets umfassen.
Das sind die Gelder, die zur Förderung spezifischer Forschungsthemen in einem harten Wettbewerb eingeworben werden – etwa beim Schweizerischen Nationalfonds, unserer wichtigsten Quelle für Drittmittel, oder beim Europäischen Förderprogramm Horizon Europe. Unsere Forschenden sind dabei sehr erfolgreich; so konnten wir uns gerade über drei neue ERC Grants freuen, die an die Universität Bern gehen. Die Erfolgsquote liegt bei diesem europäischen Fördergefäss bei zirka 15 Prozent, die Einwerbung von derart kompetitiven Geldern ist also ein Zeichen der hohen Qualität unserer Forschung. Die klassischen Drittmittel haben aber einen Nachteil: Sie sind zweckgebunden, befristet und gesamthaft nicht planbar.
Genau, aber sie können nicht für Basisaufgaben und Infrastrukturen eingesetzt werden, die den Universitätsbetrieb und damit das Einwerben von Drittmitteln überhaupt erst möglich machen. Für diese Basisaufgaben sind wir auf die Grundmittel angewiesen. Eine verlässliche Finanzierung durch den Kanton ist also Voraussetzung, damit andere uns unterstützen und damit wir Bedingungen bieten können, welche die Universität auch weiterhin attraktiv für Studierende und hoch qualifizierte Forschende machen. Das beeinflusst auch die anderen Geldquellen. Zum Beispiel, wenn sich unser Lehrangebot verschlechtert, könnten sich Maturandinnen und Maturanden aus dem Aargau verstärkt für ein Studium an der Universität Zürich entscheiden. Damit würden die erwähnten IUV-Beiträge zurückgehen, die eine wichtige Finanzquelle für viele Studiengänge, etwa in der Medizin, darstellen. Wir würden damit in eine Abwärtsspirale geraten.
Es ist bekannt, dass wir bei den Grundmitteln ein strukturelles Defizit haben. Das bedeutet, dass die Beiträge des Kantons die von ihm geforderten Aufgaben gemäss Leistungsauftrag nicht mehr zur Gänze decken. Bislang konnten wir das über Eigenkapital bei den Grundmitteln ausgleichen. Doch dieses ist aufgebraucht. Der Kanton hat inzwischen darauf reagiert und seinen Beitrag für 2025 erhöht; für 2026 ist gemäss Budget eine weitere Aufstockung vorgesehen. Wir verstehen, dass der Kanton viele verschiedene Bedürfnisse erfüllen muss, und die Universität verglichen mit anderen Bereichen gut wegkommt. Gemäss Finanzplanung des Kantons vom August ist die gewährte Erhöhung aber noch nicht für die gesamte nächste Leistungsperiode gewährleistet. Die Universitätsleitung sieht sich daher zum Handeln gezwungen, um ebenfalls einen Beitrag zur finanziellen Konsolidierung zu leisten.
Das mag auf den ersten Blick so erscheinen, aber das Eigenkapital bei den Grundmitteln ist bereits negativ. Hingegen ist das Eigenkapital bei den Drittmitteln, das Sie ansprechen, derzeit mit 318 Millionen Franken noch positiv. Aber als Folge der steigenden Unterfinanzierung würde auch das Defizit in den nächsten Jahren dramatisch ansteigen; anders ausgedrückt, spätestens in 2029 ist das Defizit bei den Grundmitteln höher als dieses Eigenkapital. Zudem gilt es zu bedenken, dass Eigenkapital nur einmal ausgegeben werden kann und dann weg ist, sich also eben nicht für die Finanzierung von Daueraufgaben eignet. Wenn wir jetzt nicht sparen, werden die Herausforderungen später nur grösser.
Wir planen über die gesamte Universität Bern mit einer Reduzierung der Grundmittel um zwei Prozent, was sowohl die Sach- als auch Personalkosten betrifft. Für alle Einheiten der UniBE bedeutet das, dass 98 Prozent der bisherigen Grundmittel das neue 100 Prozent ab 2026 sind. Die Umsetzung liegt bei den Fakultäten respektive den Dekaninnen und Dekanen sowie, für den Zentralbereich, bei der Universitätsleitung. Die Finanz- und Planungschefinnen und -chefs sind bereits informiert.
Mit den zwei Prozent erreichen wir eine Einsparung von rund 15 Millionen Franken bei einem Gesamtbudget von knapp einer Milliarde. Diese Massnahmen reichen also nicht aus, um das strukturelle Defizit zu beheben, das in diesem Jahr voraussichtlich auf 55 Millionen steigen wird. Wir setzen damit aber ein erstes Zeichen und übernehmen Verantwortung. Weitere Massnahmen werden in den kommenden Jahren diskutiert werden müssen. Langfristig müssen wir möglicherweise auch neue Wege der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und der Privatwirtschaft erkunden, um zusätzliche Ressourcen zu mobilisieren.
Ich verstehe sehr gut, dass eine Sparankündigung grosse Besorgnis bei den Mitarbeitenden auslöst. Ich möchte auf keinen Fall Versprechen abgeben, die wir später nicht einhalten können. Wir müssen realistisch sein und alle Möglichkeiten prüfen, also auch im Bereich Personal. Aber wir werden versuchen, die Massnahmen so behutsam wie möglich umzusetzen. Es ist etwa möglich, dass befristete Verträge nicht verlängert oder externe Dozierende nicht wieder angestellt werden.
Wir sind verpflichtet, in allen im Leistungsauftrag des Kantons genannten Studienfächern mindestens einen Bachelor- und Masterkurs anzubieten. Wir wollen diesen Auftrag weiterhin erfüllen und auch die Qualität hochhalten. Die konkrete Umsetzung der Einsparungen auch bei den Curricula liegt bei den Fakultäten, kleinere Auswirkungen auf die Ausbildung sind aber nicht auszuschliessen. Man muss hier kreativ sein und auch die Chancen der Digitalisierung nutzen.
Es könnte zum Beispiel sein, dass nicht-essenzielle Angebote wie Exkursionen oder Vorträge externer Expertinnen und Experten reduziert werden. Aber alle Studierenden können ihr Studium weiterführen und abschliessen; darauf haben sie einen Rechtsanspruch. Wir sind bestrebt, die Auswirkungen auf die Studierenden so gering wie möglich zu halten und ihnen die bestmögliche Unterstützung zu bieten. Unsere Priorität ist es, sicherzustellen, dass alle Studierenden ihre akademischen Ziele erreichen können.
Wegen der Sparmassnahmen müssen wir aus der Schweizer Roadmap für Forschungsinfrastrukturen 2027 aussteigen. Über diese werden notwendige Investitionen im Verbund mit anderen Hochschulen finanziert. Auch die Zukunft universitätsinterner Fördergefässe muss noch geklärt werden, wie der Investitionsfonds für kostenintensive Gerätschaften für die Forschung. Um über eine moderne, wettbewerbsfähige Infrastruktur zu verfügen, sind grössere Investitionen nötig, die derzeit nicht immer möglich sind. Die gegenwärtige Entwicklung ist sehr besorgniserregend, zumal auch durch die geplanten Massnahmen im Entlastungspaket des Bundes Fördergefässe für die Forschung und Innovation runterdimensioniert werden.
Der Kanton Bern hat das Defizit erkannt und mit den bereits erwähnten signifikanten Anpassungen seines Kantonsbeitrags für 2025 und 2026 wichtige Schritte zu einer Konsolidierung gemacht. Eine nachhaltige Lösung erfordert eine enge Zusammenarbeit mit dem Kanton und anderen Partnern, um sicherzustellen, dass die Universität Bern ihre Rolle als führende Bildungs- und Forschungseinrichtung weiterhin erfüllen kann. Mit den nun eingeleiteten Sparmassnahmen leistet die Universität bereits einen Beitrag zur Verbesserung der Lage.
Die UniBE trägt wesentlich zur wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung der Region bei, und ein Rückgang unserer Aktivitäten hätte weitreichende negative Auswirkungen. Wir bilden viele Fachkräfte für den lokalen Arbeitsmarkt aus. Ein Grossteil der Berner Tierärzte, Ärztinnen, Anwälte, Pfarrerinnen oder Lehrerinnen sind bei uns ausgebildet worden. Wenn Berner Studierende in andere Kantone gehen und dort ausgebildet werden, entstehen Kosten für den Kanton und umgekehrt fallen Erträge an anderen Universitäten an. Die UniBE ist also ein wichtiger Motor für die Entwicklung der Region und des Kantons Bern, auch ein Innovationsmotor für die Wirtschaft. Jeder investierte Franken bringt mindestens drei Franken an Wertschöpfung – wir sind also auch finanziell eine lohnende Investition.