Einstein Lectures 2025
Von der Nobelpreisträgerin zur molekularen Filmemacherin
An den Einstein Lectures wird dieses Jahr scharf geschossen. Nicht mit Kugeln, versteht sich. Sondern mit ultrakurzen Laserpulsen. Über drei Abende erklärt Physikerin Donna Strickland in Bern, wie ihre Nobelpreis-gekrönten Erfindungen Wissenschaft und Praxis bereichern.

Unweigerlich erregen Begriffe wie «Laser» und «Lichtpuls» das popkulturelle Unterbewusstsein: Vor dem inneren Auge tauchen Filmszenen aus Star Wars, Star Trek oder Krieg der Welten auf, ausserirdische Mächte schiessen Laserstrahlen durch die Luft, kämpfen mit Energieblitzen und farbigen Lichtschwertern. Die sogenannten «ultrakurzen Laserpulse», von denen am Montagabend an der Universität Bern die Rede ist, sind aber keineswegs Science Fiction. Sie werden täglich abgefeuert – nicht von mit Blastern ausgerüsteten Sturmtrupplern, sondern von Forschenden auf der ganzen Welt.
Zu verdanken hat die Wissenschaft diese «Waffe» unter anderem der Physikerin Donna Strickland. Für ihre bahnbrechenden Erfindungen auf dem Gebiet der Laser-Physik erhielt die Kanadierin 2018 als erst dritte Frau den Physik-Nobelpreis. An den diesjährigen Einstein Lectures erzählt Strickland, wie sie bis heute mit neuen Methoden immer kürzere und intensivere Laserpulse herzustellen versucht, welche überraschenden Anwendungen diese ermöglichen und wieso es trotzdem gar nicht so falsch ist, bei ihrer Arbeit an Scifi-Filme zu denken.
Einsteins optisches Erbe
«Ich wurde gebeten, Albert Einstein mindestens einmal zu erwähnen», scherzt Strickland am Beginn ihres Vortrags zu zahlreichen Lachern aus dem Publikum. Tatsächlich kommt man um den Namensgeber der Einstein Lectures kaum herum: wie vieles in der Physik beginnt auch der Laser mit Entdeckungen Einsteins. Namentlich waren es seine Arbeiten auf dem Gebiet der Optik, insbesondere zum photoelektrischen Effekt, für dessen Erklärung er 1921 den Nobelpreis erhielt, die den Grundstein für die Technologie legten.

Der Zusammenhang steckt auch im Wort. «Laser» steht für «Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation». Die «stimulierte Emission» von Strahlung kann man dabei als Gegenstück zu Einsteins photoelektrischem Effekt verstehen: Durch einen kurzen Lichtimpuls werden Elektronen in den Hüllen bestimmter Atome dazu gebracht, von einem höheren auf ein tieferes Energieniveau zu fallen. Die freiwerdende Energie wird in Form weiterer Lichtteilchen, sogenannter Photonen, ausgesendet. Bündelt man viele derart entstandene Photonen, erhält man Licht mit einer einheitlichen Wellenlänge und klarer Richtung – einen Laserstrahl.
Kürzer, stärker, besser
Donna Stricklands grosser Verdienst in der Geschichte der Laser-Forschung ist die Entwicklung der «Chirped Pulse Amplification» (CPA), einer Methode zur Herstellung ultrakurzer, aber hochintensiver Lichtpulse. Dies gelang ihr bereits Mitte der 1980er, als Doktorandin am Labor ihres mit-Nobelpreisträgers Gérard Mourou.
Anders als alltägliche Anwendungen wie der Laserpointer, mit dem Strickland während ihres Vortrags passenderweise hantiert, produziert die CPA keine kontinuierlichen Strahlen, sondern periodische Lichtblitze. Solche Blitze haben verblüffende Eigenschaften. Zum einen können sie ultrakurz sein: Ein einziger Laserpuls kann nur wenige Millionstel eines Milliardstels einer Sekunde dauern. Zum anderen erlauben sie eine enorme Leistungssteigerung: Anders als beim kontinuierlichen Laser, wo sich die Leistung entlang des Strahls verteilt, wird sie bei einem pulsierenden Laser in den Pulsmaxima konzentriert. Bei gleicher durchschnittlicher Leistung können einzelne Lichtblitze so mehrere Tera- oder gar Petawatt erreichen.
Vor Strickland und Mourou waren derart immense Leistungen – ein Petawatt entspricht 0,5% der gesamten Sonnenergie, die die Erde zu jedem Zeitpunkt erreicht – jedoch ein Problem: Die hochintensiven Photonen erzeugten nicht-lineare Effekte und drohten, die Laserapparaturen von innen zu zerstören. Erst die CPA, bei der Laserpulse zunächst gestreckt, dann verstärkt und wieder komprimiert werden, ermöglichte eine sichere und unkomplizierte Produktion der ultrakurzen Lichtblitze.
Kameras für «Molekulare Movies»
Heute finden Stricklands Laserpulse vielfältige Verwendung. Sie werden bei Augen-Laser-Operationen eingesetzt, um hochpräzise Schnitte zu setzen, dienen in der Materialverarbeitung zur Herstellung kleinster Bauteile und könnten die nächste Generation von Teilchenbeschleunigern auszeichnen.

Strickland selbst hat aber noch ganz anderes vor Augen, sie will «molekulare Movies» machen:
Dabei geht es ihr darum, die Struktur komplexer Moleküle und deren Bewegungen in grösstmöglicher Auflösung abzubilden. Dafür seien noch kürzere, noch stärkere Laserpulse nötig, erklärt Strickland. Sie gesellt sich damit zu Pionieren der Fototechnik wie Edward Muybridge und Harold Edgerton. Und sie versucht sich auch gleich als Filmemacherin: Mit verhaltenem Stolz zeigt Strickland selbstgemachte Powerpoint-Animationen ihrer «Movie Stars» – vibrierende Atome und kreisende Moleküle.
Zwar könne man bereits Pulse mit der für die «molekularen Filme» nötigen Kürze herstellen, so Strickland, doch es fehle noch an der Intensität. Ziel sei es nämlich, eine sogenannte «Coulomb Explosion» herbeizuführen: Dabei ionisieren die hochintensiven Laserpulse Atome in den beschossenen Molekülen und bringen dieses dazu, auseinanderzuspringen. Die Geschwindigkeit der wegfliegenden Atome lässt dann Rückschlüsse über die Struktur des jeweiligen Moleküls zu.
Die Jagd nach Pulsen geht weiter
Was Strickland danach über ihre Versuche zur Herstellung neuer Laserpulse und den dabei verwendeten Techniken wie «Modenkoppelung», «Harmonische Generation» und «Raman-Streuung» erzählt, mag manchen Nichtkundigen etwas zu schnell gehen. Eines bleibt aber immer verständlich: dass Donna Stricklands Begeisterung für die Welt der Laser auch vierzig Jahre nach ihrer bahnbrechenden Erfindung nicht nachgelassen hat – und dass sie trotz Nobelpreis-Trubel noch immer nach neuen Pulsen und Anwendungen jagt.

An den kommenden Vorlesungen wird sich Strickland zwei solcher Anwendungen näher annehmen: Am heutigen Dienstag spricht sie über die Bekämpfung von Tumoren und morgen Mittwoch über die Überwachung der Umwelt und des Klimas mit Hilfe von Laserpulsen. Das klingt dann doch wieder ein wenig nach Science Fiction … bleibt es aber, wenn Strickland und ihre Kolleginnen und Kollegen erfolgreich sind, hoffentlich nicht.
Weitere Vorträge
Dienstag, 21. Oktober 2025, 17:15 Uhr – Particle acceleration with intense fiber lasers for medical applications
Mittwoch, 22. Oktober 2025, 19.30 Uhr – Global Environmental Measurement and Monitoring (GEMM)
Die Einstein Lectures finden im Hauptgebäude der Universität Bern statt. Sie sind öffentlich und kostenlos. Vortragssprache ist Englisch.
Über Donna Strickland
Donna Theo Strickland ist Professorin für Physik an der University of Waterloo in Kanada und erhielt 2018 für bahnbrechende Erfindungen im Bereich der Laserphysik zusammen mit Gérard Mourou und Arthur Ashkin den Nobelpreis für Physik. Strickland war nach Marie Curie im Jahre 1903 und Maria Goeppert Mayer im Jahre 1963 nach weiteren 55 Jahren erst die dritte Frau, die den Nobelpreis für Physik erhielt.
Über die Einstein Lectures
Im Andenken an das Werk von Albert Einstein widmen sich die Einstein Lectures abwechselnd Themen aus der Philosophie, Mathematik sowie der Physik und Astronomie. Die Einstein Lectures sind eine Kooperation zwischen der Albert Einstein Gesellschaft und der Universität Bern und finden seit 2009 jährlich statt.
uniAKTUELL-Newsletter abonnieren
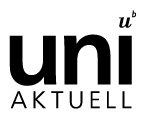
Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.




