Berner Wissenschaft
Lokale Forschung mit Blick aufs Globale
Wissenschaft kennt keine Grenzen und ist doch oft lokal verankert. Anhand von Berner Beispielen zeigt sich, wie Forschung zwischen Alpenraum und Weltbühne oszilliert, gesellschaftlich wirkt und neue Formen der Nähe sucht.

«Wir sind uns alle einig», sagte Ursula von der Leyen unlängst, «dass die Wissenschaft keinen Pass, kein Geschlecht, keine ethnische Zugehörigkeit und keine Zugehörigkeit zu einer politischen Partei hat.» Vorausgesetzt, dass wir da tatsächlich einiggehen mit der Präsidentin der Europäischen Kommission: Welche Zugehörigkeit bleibt der Wissenschaft denn dann? Vielleicht gibt es darauf genau zwei, ziemlich polar entgegengesetzte Antworten: Entweder muss die Wissenschaft tatsächlich ganz ohne Zugehörigkeit auskommen und nimmt deshalb Zuflucht zu einem Abstraktum, einer Art «Science Nation». Oder sie findet durchaus Wurzeln im Lokalen, identifiziert sich mit der eigenen Hochschule und – bestenfalls damit einhergehend – der damit verbundenen Region.
Die Alpen als Labor
Wie sich ein guter Boden für die Forschung formiert, fragt man vielleicht als Erstes den Geologen und Sedimentspezialisten. Nicht ganz überraschend: Fritz Schluneggers Experimentierfeld findet sich denn auch gleich vor der Haustüre. «Die Alpen sind tatsächlich ein ideales Labor für unsere Forschung», sagt er. Und die dreht sich ganz um nicht-menschliche Zeiträume, um die Entstehung von Gesteinen und die darauffolgende Erosion. Insbesondere untersucht Schlunegger, wie aus den Alpen allmählich Mittelland wird, wie das Gestein von den Bergen hinabkommt und im Flachland abgelagert wird.
Zur Person

Fritz Schlunegger
ist ordentlicher Professor für Exogene Geologie am Institut für Geologie der Universität Bern.
Gewissermassen als Kontrastmittel zu den Vorgängen hierzulande interessiert sich der Geologe aber auch für Sedimentationsprozesse in Peru. «Bei uns ist die Landschaftsform komplett durch die letzten Vereisungen gestaltet, in den Anden ist das ein wenig anders.» Dass er gerade in Bern forscht, sei letztlich auch ein wenig dem Zufall geschuldet, sagt Schlunegger: «Es wurde eine Stelle an der Uni Bern frei, also habe ich mich beworben.» Da ist Schlunegger ganz der mobile Forscher, wie er heute in allen Disziplinen die Norm ist – diesen international offenen Horizont trifft man eigentlich immer an, wenn man mit Berner Forschenden über ihre Projekte und deren Verortung spricht, sei es in der Dialektforschung, sei es in der Geografie oder im Bereich Public Health.
Kennt die Wissenschaft Grenzen?
Diese hohe Mobilität und der internationale Fokus gehen natürlich einher mit einem ständigen Wettbewerb um die besten Köpfe. Das konnte man gerade wieder erleben im Zusammenhang mit den Angriffen auf amerikanische Universitäten und der allenthalben in Europa geäusserten Hoffnung, die eine oder andere Spitzenkraft über den Atlantik locken zu können. Von der Leyens Statement war denn auch weniger eine philosophische Überlegung zum Wesen der Wissenschaft, sondern ein Aufruf, ausgesprochen an der Sorbonne zusammen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron: Europa soll ein Zufluchtsort für Forschende aus der ganzen Welt werden, ein politisches Exil gewissermassen für «wissenschaftliche Flüchtlinge», wie es Macron nannte. Aber kann es denn Flüchtlinge geben, wo es keine Pässe gibt? Können Forschende ihrer Arbeit im Prinzip überall auf der Welt nachgehen, ohne grossen Unterschied?
Magazin uniFOKUS

«Ein Teil von Bern»
Dieser Artikel erschien erstmals in uniFOKUS, dem Printmagazin der Universität Bern. uniFOKUS beleuchtet viermal pro Jahr einen thematischen Schwerpunkt aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Aktuelles Fokusthema: «Ein Teil von Bern»
Regionale Verankerung als Forschungsbasis
Heike Mayer würde da auf jeden Fall widersprechen wollen. Die Wirtschaftsgeografin und Vizerektorin der Uni Bern empfindet die regionale Einbindung als «sehr stark und prägend», sie lasse sich auf jeden Fall inspirieren vom Umfeld – wo sie wohne, wo sie arbeite. Sie arbeite durchaus auch international, so etwa in einem Projekt zum Vergleich von Frauen als Unternehmensgründerinnen in der Schweiz, in Kolumbien und in Deutschland. Aber sie wolle sich da «nicht verbiegen»: Wo sie keinen Hintergrund habe, wo es ihr auch an Daten fehle, da könne sie keine fruchtbare Forschung machen. Lieber beschäftigt sie sich mit der Frage, wie sich Bern als Hauptstadtregion positionieren kann. Oder sie entwickelt in Bachelor- und Masterprojekten Ideen, wie Thun als elftgrösste Stadt der Schweiz aus dem Schatten von Bern heraustreten könnte. Besonders am Herzen liegen ihr aber die oft ein wenig abgehängten Berggebiete, spezifisch im Berner Oberland. Da erforscht sie beispielsweise, was man mit sozialer Innovation gegen den Fachkräftemangel tun kann – zum Beispiel, indem man die medizinische Grundversorgung mit anderen Dienstleistungen kombiniert.
«Die Unis müssen überlegen, wie sie Beiträge leisten können, um die grossen Herausforderungen der Zeit anzugehen.»
Heike Mayer
Insgesamt ist Mayer überzeugt, dass sich «die Unis überlegen müssen, wie sie Beiträge leisten können, um die grossen Herausforderungen der Zeit anzugehen». Das erfordere auch andere Zugänge, Transdisziplinarität ist für sie entscheidend: Forschungsprojekte sollten lokale Partner sowie die Bevölkerung miteinbeziehen, was bedeuten kann, dass schon die Forschungsfrage offener formuliert wird. Welche Forschung machen wir, welche brauchen wir: das sollte viel öfter gemeinsam mit den Betroffenen reflektiert werden.
Zur Person

Heike Mayer
ist Vizerektorin für Qualität und Nachhaltige Entwicklung und ordentliche Professorin für Wirtschaftsgeographie am Geographischen Institut der Universität Bern.
Frucht dieser Überlegungen ist auch die Initiative «Engaged UniBE» mit dem Ziel der besseren Verankerung der Universität in der Gesellschaft. Man möchte Studierende, Lehrende und Mitarbeitende in ihrem Engagement und Austausch mit der Gesellschaft unterstützen, um den Wissenstransfer zu fördern und überhaupt andere Arten der Wissensproduktion zu entwickeln.
Der Bevölkerung etwas zurückgeben
Wissenstransfer? Engagement für die Gesellschaft? Da kommt einem natürlich automatisch der notorische «Steuerfranken» in den Sinn, die Bringschuld der öffentlichen Hand gegenüber, die den ganzen Betrieb ja letztlich bezahlt (mehr dazu auf den Seiten 26 und 27). Dem Linguisten und Dialektforscher Adrian Leemann fällt es nicht allzu schwer, einen wirtschaftlich-gesellschaftlichen Nutzen nachzuweisen: Zunächst einmal gehe es natürlich darum, ein kulturelles Gut zu dokumentieren, und zwar eines, das so eng an Identität gekoppelt ist wie kaum eines sonst. Er kann aber auch Handfesteres aufzählen: «Unsere Forschung ist auch für die Forensik relevant, wenn es darum geht, Deepfake-Stimmanrufe zu entlarven.» Diese stolpern ausgerechnet über die Feinheiten des Dialekts, aber um das im Detail nachzuweisen, brauche es gut dokumentierte Grundlagen. Umgekehrt interessieren sich auch Chatbot-Start-ups für seine Forschung. Aber auch Leemann hat nicht allein das Lokale im Blick, er habe auch Dialekte in England, Deutschland und Österreich studiert. Aber sein Hauptinteresse gilt dem Schweizerdeutschen. Er weiss, dass Forschende da unterschiedlich motiviert sind, was die «Nähe zu den Leuten» angeht. «Ich persönlich finde es spannend, wenn es die Leute anspricht und einen konkreten Nutzen hat.»
Zur Person

Adrian Leemann
ist ordentlicher Professor am Institut für Germanistik der Universität Bern und erforscht Sprache und Gesellschaft, (forensische) Phonetik, Dialekte und innovative Methoden der Linguistik.
Lokale Probleme – und darüber hinaus
Auch für die Tourismusforscherin Monika Bandi ist Forschung selbstverständlich ein Geben und Nehmen. Dieser «Austausch mit den Stakeholdern» ist für sie Alltag: «Ich muss ihnen zuhören, sonst kann ich nicht erwarten, dass sie uns zuhören.» Ihre Arbeit besteht also einerseits darin, «viele Interviews zu führen», andererseits darin, das Wissen wieder in die Region zurückzutragen. Ähnlich wie von Mayer gefordert folgt sie dabei einem «problemorientierten Forschungsansatz»: Sie versuche immer herauszufinden, «was die Leute denn eigentlich beschäftigt». Aber auch da gilt: Reine Nabelschau wird keine betrieben, der Blick geht immer mal wieder über den regionalen Tellerrand hinaus. «Das Internationale braucht es schon», sagt Bandi, wobei sie sich eher in einen europäischen Kontext eingebettet fühlt, da habe sie ihr Netzwerk. Sie nennt das Beispiel Polen: Da wurde touristische Entwicklung erst in den 1990er-Jahren möglich – ein ganz anderer Hintergrund als die 150-jährige Tourismusgeschichte der Schweiz, aber genau das mache die Zusammenarbeit spannend. Zu einer aktuellen Forschungsfrage kam sie via Medienberichterstattung. «Man liest ja immer mal wieder, die Schweiz sei global auf dem letzten Platz in Sachen Gastfreundlichkeit.» Das regte die Forschungsneugier an: Bandi glaubt nicht, dass man das sinnvoll mit Stichproben erheben kann, «Online-Reviews auf Google oder Tripadvisor sind da auf jeden Fall adäquater». Auf diese Weise macht sie sich daran, den Mythos des besonders unfreundlichen Gastgeberlands (den wohl in Variationen so gut wie jede Tourismusregion kennt) zu überprüfen und je nach Ergebnis gemeinsam mit den Destinationen Verbesserungsmassnahmen zu entwickeln.
Zur Person

Monika Bandi
ist Leiterin der Forschungsstelle Tourismus (CRED-T) am Center for Regional Economic Development (CRED) der Universität Bern.
Der Welt verpflichtet
Eine unbestrittene Schweizer Exklusivität ist dagegen der «sehr hohe Stellenwert des Dialekts»; insofern versteht man auch den Entscheid Leemanns, auf das Lokale zu fokussieren. Mit der Gen Z geht die Tendenz tatsächlich sogar noch stärker hin zur Mundart, heute sei es ganz normal, dass Jugendliche ihre Tagebücher in Mundart schreiben: Gesprochene Sprache werde so verschriftlicht. Gleichzeitig gebe es eine Verdeutschung im Wortschatz – immer mehr Menschen sagten zum Beispiel «Schmetterling» statt etwa «Pfiffoltera». Ob diese Entwicklungen gut oder schlecht seien, interessiert dabei eher weniger: «Es ist nicht unsere Aufgabe als Linguistinnen und Linguisten, den Sprachwandel zu bewerten, wir beobachten, was passiert.» Insofern mache man Forschung auch immer «für die grössere Forschungs-Community»: Die exakte Beobachtung eines Mikrokosmos spiegelt sich an der weiten Welt.
uniAKTUELL-Newsletter abonnieren
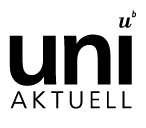
Entdecken Sie Geschichten rund um die Universität Bern und die Menschen dahinter.
Das hätte der Gründervater des Schweizerischen Nationalfonds (SNF), der Berner Physiologie-Professor Alexander von Muralt, vorbehaltlos unterschrieben. Denn interessanterweise sollte die Tätigkeit des 1952 gegründeten Nationalfonds nicht nur der Schweiz Nutzen bringen. Das Land war vom Krieg verschont worden, deshalb hielten es die Gründer des SNF für eine Pflicht gegenüber der Welt und insbesondere gegenüber Europa, die Forschung zu fördern und auf diese Weise am Wiederaufbau mitzuarbeiten. Auch da also schon: Mikrokosmen und weite Welten.
Dank Lokalbezug besser auf die nächste Pandemie vorbereitet
Den vielleicht frappierendsten lokal-globalen Spagat findet man beim Projekt «BEready», angesiedelt am Multidisciplinary Center for Infectious Diseases (MCID). Zustande gekommen ist das Projekt dank einer substanziellen Finanzspritze der Bieler Stiftung Vinetum, was zunächst eine «komplette Freiheit» bei der Ausgestaltung des Projekts bedeutet habe, sagt die Leiterin Nicola Low. Noch während der Coronapandemie sei die Stiftung auf die Uni zugekommen, mit der Motivation, die Forschung über Infektionskrankheiten zu verbessern. Komplette Freiheit zwar, aber auch hier war rasch klar: Der Lokalbezug wird zentral sein. Low: «Uns war es wichtig, im Kanton Bern verankert zu sein und unsere Bevölkerung besser kennenzulernen.» Und die Projektmanagerin Eva Maria Hodel ergänzt, dass ihre Forschungsmotivation unmittelbar an dieses direkte Feedback gekoppelt sei; das habe vielleicht auch damit zu tun, dass sie ursprünglich Apothekerin sei. «Ich bin eher nicht so begeistert von Elfenbeinforschung, darum bin ich wohl auch in der Epidemiologie gelandet und nicht im Labor.» Sie möchte, sagt sie, gesellschaftsrelevante Forschung machen. Gemeinsam mit den Menschen für die Menschen.
«Es geht schliesslich auch um Vertrauen, es geht darum, eine längerfristige Beziehung aufzubauen.»
Eva Maria Hodel
So baut das Team nun eine Berner Kohorte auf, einen medizinischen Mikrokosmos gewissermassen, eingeschlossen werden auch ganze Haushalte, sogar inklusive Haustiere. «Wenn wir die Übertragungswege von Infektionskrankheiten beobachten wollen, macht eine lokale Kohortenstudie mit ganzen Haushalten Sinn, da reale Kontaktstrukturen darin besser abgebildet werden als in einer verstreuten Stichprobe.» Der Lokalbezug sei auch extrem hilfreich bei der Rekrutierung, sagt Hodel: Man müsse die Teilnehmenden nicht davon überzeugen, «irgendetwas» für «irgendeine internationale Initiative» zu machen – «wir sind direkt im Dialog mit den Menschen, es geht schliesslich auch um Vertrauen, es geht darum, eine längerfristige Beziehung aufzubauen».
Zur Person

Nicola Low
ist Professorin für Epidemiologie und Public Health am Institut für Sozial- und Präventivmedizin (ISPM) und Leiterin des Projekts «BEready» am Multidisciplinary Center for Infectious Diseases (MCID) der Universität Bern.
Wobei wir natürlich gerade im Fall von Covid daran erinnert worden sind, dass Viren ganz und gar nicht regional ausgerichtet sind und weder Kantons- noch Ländergrenzen kennen. Natürlich seien sie international gut vernetzt, stimmt Low zu. Auch hier wieder kann man vom Kleinen für das Grosse lernen: «Bern gibt demografisch gesehen ein gutes Bild für die ganze Schweiz ab.» Während der Pandemie hätte man solche Daten, wie sie mit BEready hoffentlich zusammenkommen werden, dringend nötig gehabt: «Uns fehlten zum Beispiel Informationen zu sozialen Kontakten zwischen unterschiedlichen Altersgruppen», sagt Hodel. Das hatte direkte Auswirkungen, zum Beispiel auf Schulschliessungen: Waren die tatsächlich nötig? Um das zu beantworten, griff man auf Daten aus dem Ausland zurück und behalf sich mit Modellierungen, um die lokalen Begebenheiten zu verstehen, aber das Wissen blieb sehr löchrig. «Genau solche Daten sind es, die wir bei BEready sammeln», sagt Low.
Zur Person

Eva Maria Hodel
ist Managerin des Projekts «BEready» Multidisciplinary Center for Infectious Diseases (MCID) der Universität Bern.
Die Unabhängigkeit wahren
Auch Leemann beschreibt, wie «unglaublich nah» seine Forschung bei den Leuten sei, er nennt es ein «Privileg», einen solchen Untersuchungsgegenstand zu haben, ständig werde er eingeladen, von Dialektvereinen zum Beispiel. Er ist der Ansicht, dass es angesichts globaler Herausforderungen wie Klimakrise und Ukraine sinnvoll sei, dass Forschende gelegentlich reflektieren, inwieweit ein rein akademischer Rückzug noch zeitgemäss ist. Auch Heike Mayer fühlt sich vom Anspruch getrieben, die «Probleme der Zeit zu lösen». Allerdings bringe, gibt sie zu bedenken, gerade der Austausch mit lokalen Interessengruppen immer die Gefahr mit sich, in ein politisches Lager gesteckt zu werden. Die Unabhängigkeit der Forschung gelte es da immer zu verteidigen. Denn gerade die Einbindung in konkrete, lokal verankerte Projekte macht deutlich: Neutralität in ihrer bequemsten, auch in ihrer naivsten Form kann es nur im Elfenbeinturm geben. «Man hat als Forschende eine Machtposition», sagt Mayer, «dessen muss man sich immer bewusst sein.»
Engaged UniBE: Eine Brücke zwischen Universität und Gesellschaft
Unsere Gesellschaft sieht sich grossen Herausforderungen gegenüber: Dazu gehören Klimawandel und -anpassung, der Verlust der Biodiversität, der demografische Wandel und die Auswirkungen der Digitalisierung. Um diese Herausforderungen zu meistern, ist ein gesellschaftlicher Dialog unerlässlich. Engaged UniBE ist eine Initiative der Universität Bern, die diesen Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft aktiv fördern und die Universität stärker in der Gesellschaft verankern möchte.

