Istituto di italiano giuridico
«Die Bundesstadt Bern ist prädestiniert für dieses Institut»
Die Universität Bern stärkt die Stellung der italienischen Sprache im Recht. Iole Fargnoli, Gründerin und Direktorin des neuen Instituts für italienische Rechtssprache, erklärt, weshalb Bern der ideale Standort dafür ist.

Das neue Institut für juristische Italienische Sprache der Universität Bern (Istituto di italiano giuridico) ist das erste universitäre Zentrum, das sich der Förderung und Erforschung der italienischen Rechtssprache widmet: ein Kompetenzzentrum, das nicht nur in der Schweiz, sondern auch auf europäischer Ebene einzigartig ist.
Die Initiative für die Gründung des Instituts geht auf Iole Fargnoli zurück, Professorin an der Rechtwissenschaftlichen Fakultät in Bern. Sie störte sich daran, dass das Italienische auch im juristischen Kontext im Vergleich zum Englischen immer weniger verwendet wird, obwohl das Italienische verfassungsrechtlich auf demselben Niveau wie das Deutsche und das Französische steht.
Auch fielen ihr die Schwierigkeiten auf, die italienischsprachige Studierende an der Universität Bern mit deutschen Begriffen und Konzepten haben, die sich nicht einfach übersetzen lassen. Auf Deutsch «Jus» zu studieren ist für sie vor allem am Anfang des Studiums eine grosse Herausforderung.
Iole Fargnoli Lassen Sie mich darauf zunächst eine allgemeine Antwort geben: Das Recht ist grundlegendes Element einer funktionierenden Gesellschaft, es organisiert unser Zusammenleben. Und das grundlegende Werkzeug des Rechts wiederum ist die Sprache. Ohne Wörter können die Juristinnen und Juristen nicht arbeiten, und deshalb ist es wichtig, dass wir uns um ein Verständnis dieser Wörter bemühen.
Ja, es geht um eine ganz spezifische Sprache, das stimmt. Und diese Sprache hat ihren ganz eigenen Stil. Für Nicht-Juristen mag er schwer verständlich oder zumindest gewöhnungsbedürftig sein. Man darf aber nicht vergessen: Es handelt sich um eine Fachsprache, sie hat ihre eigenen Qualitäten, die aber auch Notwendigkeiten sind.
«Ohne Sprache kein Recht. Deshalb ist es so wichtig, die juristische Sprache genau zu erforschen, als Grundlage.»
– Iole Fargnoli
Das ist ein erhellender Vergleich. Natürlich ist Sprache auch für die Medizin wichtig, aber die Verbindung ist beim Recht ungleich stärker. Ohne Sprache kein Recht. Deshalb ist es so wichtig, die juristische Sprache genau zu erforschen, gewissermassen als Grundlage zur Erforschung des Rechts.
Durchaus nicht! Bern als Bundesstadt ist prädestiniert für ein solches Institut. Und der Kanton Bern verkörpert ja auch ein wenig die Mehrsprachigkeit, die so grundlegend ist für das Schweizer Selbst-, aber auch Rechtsverständnis. Aber es geht nicht allein um die symbolische Bedeutung. Hier in Bern wird sehr viel konkrete rechtssprachliche Arbeit geleistet, rund ums Bundeshaus, im exekutiven und legislativen Alltag.
«In Bern wird sehr viel konkrete rechtssprachliche Arbeit geleistet, rund ums Bundeshaus, im exekutiven und legislativen Alltag.»
– Iole Fargnoli
Natürlich. Aber damit ist es nicht getan: Eine Übersetzung ist eben keine ganz exakte Entsprechung, es ist immer eine Interpretation. Das gilt nicht nur bei literarischen Übersetzungen, sondern es gilt auch bei Gesetzen. Ein Gesetz liegt in der Schweiz insofern in drei Versionen vor und alle drei sind offizielle Fassungen. Auch Gerichtsurteile werden nicht nur auf Deutsch, sondern auch in den anderen Sprachen der Eidgenossenschaft verfasst. Hier hängt die Wahl der Sprache vom jeweiligen Kanton und dem zuständigen Gericht ab. Das Bundesstrafgericht in Bellinzona publiziert die Urteile dementsprechend auf Italienisch.
uniAKTUELL-Newsletter abonnieren
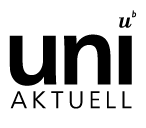
Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.
Im Prinzip ja. Denken Sie an die erwähnten Urteile des Bundesstrafgerichts in Bellinzona auf Italienisch. Es ist heikel, sich da nur auf Übersetzungen zu verlassen. Aber im konkreten juristischen Alltag kommt es natürlich immer auf die Sprachkenntnisse der einzelnen Richterinnen und Anwälte an.
Wir wollen zunächst einmal funktionierende Schnittstellen zwischen Recht- und Sprachwissenschaft aufbauen und ein entsprechendes Netzwerk pflegen, mit Institutionen im In- und Ausland. Wir möchten die Besonderheiten der italienischen Rechtssprache in der Schweiz untersuchen, und nicht zuletzt interessiert uns auch die historische Perspektive.

Das römische Recht ist Grundlage des Privatrechts und wirkt bis heute stark nach, insofern ist das immer noch ein wichtiger Forschungsinhalt. Hier ist übrigens wiederum das Italienische von Bedeutung, denn wer sich in die aktuelle Forschung zu römischem Recht vertiefen will, muss zwingend Italienisch können: Die meisten Fachpublikationen in dem Bereich sind auf Italienisch.
Das ist ein spannendes Gebiet: So wie das Recht eine Geschichte hat, hat sie natürlich auch die Sprache des Rechts. Die Rechtssprache entwickelt sich immer weiter, manche Begriffe aber bleiben: So spricht man zum Beispiel immer noch von «Treu und Glauben». Es ist aber auch spannend zu sehen, wie sich die Mehrsprachigkeit der Schweiz auf die Entwicklung der juristischen Sprache auswirkte, im Vergleich mit dem angrenzenden Ausland. Man erkennt da eine Tendenz zu einer gewissen Einfachheit der Sprache. Man versuchte die anderssprachigen Juristen also nicht zu überfordern beim Formulieren.
Ja, ein wichtiger Aspekt ist didaktischer Natur: Wenn es an einer deutschsprachigen Universität keine Vorlesungen auf Italienisch gibt, dann fehlt da etwas in der Ausbildung. Alles nur noch auf Englisch zu machen wäre das falsche Signal, denn je nach Berufswunsch kann es für zukünftige Juristinnen und Juristen entscheidend sein, die Fachtermini eben auch in anderen Amtssprachen zu kennen – wenn sie ins Tessin zurückkehren, dann brauchen sie das. Ein entsprechendes Angebot macht Bern natürlich attraktiv für diese Studierenden.
«Alles nur noch auf Englisch zu machen wäre das falsche Signal.»
– Iole Fargnoli
Für die Studierenden sind solche Technologien Alltag, klar. Und sie durchdringen immer stärker auch unseren Alltag und auch die Forschung. Zur Hilfestellung finde ich das nicht verkehrt – ich bin allerdings skeptisch, was den konkreten Nutzen bei juristischen Sachfragen angeht. Eine maschinelle Übersetzung muss man auf jeden Fall von jemandem mit Fachwissen prüfen lassen.
Wir möchten das Institut explizit als Laboratorium etablieren, insofern wird auch die Konfrontation mit der Künstlichen Intelligenz wichtig und spannend sein. Aber ich möchte nicht erleben, dass wir juristisches Urteilen Robotern überlassen. Noch ist das Erkennen von und Arbeiten mit sprachlichen Nuancen eine menschliche Domäne. Und wird es aller Voraussicht im juristischen Kontext auch bleiben.
Zur Person

Iole Fargnoli ist ordentliche Professorin für Römisches Recht an der Universität Bern und an der Università degli Studi di Milano. Ihre Forschungsschwerpunkte sind das römische Recht als Grundlage der europäischen und extraeuropäischen Rechtskultur, die Rechtsgeschichte in der Spätantike und die Wissenschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts. Sie ist auch Adjunt Professor an der Soochow University und Honorarprofessorin an drei chinesischen Universitäten: der Shaanxi Normal University, der Yuncheng University und der China University of Political Science and Law in Shanghai.
Zum Institut für italienische Rechtssprache der Universität Bern
Das Institut für juristische Italienische Sprache der Universität Bern (Istituto di italiano giuri-dico) ist das erste universitäre Zentrum, das sich der Aufwertung, Förderung und Erforschung der italienischen Rechtssprache widmet. Da Italienisch eine der Amtssprachen der Schweiz ist, werden normative Texte wie Gesetze oder Verordnungen, prozessuale Anwendungstexte wie Urteile sowie verwaltungsrechtliche Texte wie Erlasse auch auf Italienisch verfasst. Eben-so entstehen in dieser Sprache interpretative Texte wie Monografien, Kommentare und wis-senschaftliche Artikel. Das neue Institut der Universität Bern wurde in der Stadt gegründet, in der sich die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrat befinden, und pflegt daher einen direkten Dialog und eine enge Zusammenarbeit mit der Bun-deskanzlei, Sektion Gesetzgebung und Sprache, und dem Staatsrat des Kantons Tessin.


