Medienwissenschaft
Umgang mit Verschwörungstheorien: Widerspruch wirkt
Berner Forschende haben während der Corona-Pandemie live analysiert, wie Medien am effektivsten Verschwörungstheorien eindämmen können. Ein Workshop für Journalistinnen und Journalisten brachte Wissenschaft und Praxis zusammen.
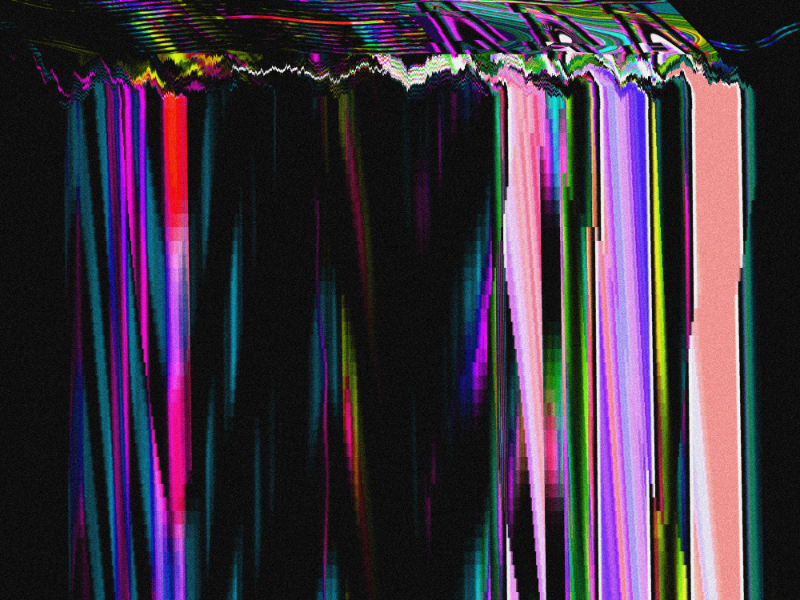
Eine chinesische Biowaffe! Bill Gates! 5G! Asterix und Obelix! Die globale Coronavirus-Pandemie vor fünf Jahren brachte Anhängerinnen und Anhänger von Verschwörungstheorien auf Hochtouren. Sie überboten sich im Erklären, wer oder was «in Wahrheit» dahinterstecke und Covid-19 «erfunden» habe.
Während der Pandemie erlebten fast alle Journalistinnen und Journalisten hierzulande, die über Corona berichteten, Druckversuche und Einflussnahme von aussen auf ihre Arbeit. Zurückzuführen sei das gemäss dem «Jahrbuch Qualität in den Medien» aus dem Jahr 2022 auf die «allgemeine Verbreitung» von Verschwörungstheorien in dieser Zeit.
Verschwörungstheorien: langlebig und gefährlich
Jede vierte Person in der Deutschschweiz und in Deutschland glaubte während der Pandemie teils oder ganz an Verschwörungstheorien. Rund 26 Prozent der Deutschschweizer Bevölkerung dachte, Regierung und Politik wollten Angst verbreiten und hätten Böses im Sinn. Das zeigt eine neue, grossangelegte Studie des Instituts für Kommunikations- und Medienwissenschaft (IKMB) der Universität Bern aus der Pandemiezeit und danach.
Mehr zur Studie
Das Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Bern führte zwischen 2020 und 2024 die repräsentative Studie «Preparing the mainstream media for the next pandemic» mit Onlinetracking, Befragungen und einem Experiment durch. Insgesamt über 3000 Personen aus der Deutschschweiz und Deutschland nahmen teil. Das Multidisciplinary Center for Infectious Diseases (MCID) hat die Studie finanziert.
Eine Verschwörungstheorie ist «eine Aussage, die eine Anschuldigung macht, dass jemand, meistens eine Elite, in eine üble Machenschaft involviert ist, die einer grösseren Allgemeinheit schadet», erklärt Tobias Rohrbach, Medienwissenschaftler am IKMB.
Es ist ein sich selbst aufrechterhaltendes System, resistent gegen Fakten und Argumente. Fehlende Belege werden als Beweis verstanden, dass etwas vertuscht wird. Verschwörungstheorien – oder auch Verschwörungserzählungen, -narrative, -mythen, -ideologie genannt – sind oft langlebig. Und sie können Individuen und Gesellschaften massiv schaden, Vertrauen erodieren, Gewalt und Hetze antreiben. Unter anderem gedeihen in diesem Milieu Klimawandel-Leugner, Impf-Gegnerinnen, staatsverweigernde und antisemitische Gruppierungen.

«Daher ist eine Hauptüberlegung der Wissenschaft, zu schauen, wie man Verschwörungstheorien eindämmen kann, bevor sie sich in der Öffentlichkeit verbreiten», sagt Tobias Rohrbach.
Einzigartige Studie in Echtzeit
Hier setzt die Studie des IKMB an. Sie zeigt: In einer unsicheren Informationslage, wie sie Krisen an sich haben, sind Medien wichtige «Kontaktpunkte» – und zwar nicht nur alternative Plattformen und Social Media, sondern auch klassische Massenmedien. Hier kann jemand zum ersten Mal von einer Verschwörungstheorie erfahren.
«Es ist aussergewöhnlich, dass wir bereits methodisch im Feld und ab Tag eins der Pandemie parat waren.»
Tobias Rohrbach
Über welche Kanäle dubiose Theorien an eine Leserschaft gelangten, wurde in der Studie mithilfe von Onlinetracking analysiert. Hierfür trainierten die Forschenden ein Textanalyse-Programm mit einem Algorithmus, der Sätze mit Verschwörungslogik und -inhalten erkennt. In Echtzeit liessen sie das Programm dann die Textbeiträge aufzeichnen und auswerten, welche Probandinnen und Probanden beim täglichen Surfen im Internet und auf Social Media anschauten. Insgesamt machten bei dem Teil der Studie 1000 Personen mit.
Damit betraten die Forscherinnen und Forscher Neuland – denn meistens wird zu Verschwörungstheorien geforscht, die es schon länger gibt. «Es ist aussergewöhnlich und ein glücklicher Zufall, dass wir bereits methodisch im Feld und ab Tag eins der Pandemie parat waren», sagt Tobias Rohrbach. Die Mitarbeitenden des Instituts passten spontan das Thema einer Studie an, die sie damals gerade zu politischer Information im Internet starten wollten.
NZZ und Co. trugen ihren Teil bei
Durchschnittlich sieben Prozent aller angeschauten Textbeiträge in den ersten drei Monaten der Pandemie enthielten Verschwörungstheorien. Alle Quellentypen waren betroffen. Vor allem alternative Plattformen unterstützten erwartungsgemäss Verschwörungstheorien.
Kritisch und oppositionell über verschwörungsbezogene Inhalte berichteten vor allem die Medien – doch auch dort, selbst in Qualitätsmedien wie SRF, NZZ oder Tages-Anzeiger, gab es unkritische oder unterstützende Positionen. Das war laut Tobias Rohrbach vor allem in der Anfangsphase der Pandemie und eher unabsichtlich der Fall: «Damals war noch sehr vieles unklar. In diesem Kontext berichteten die Medien manchmal zu schnell über Aussagen und Gerüchte, die sich später als falsch erwiesen.»

Damit förderten Medien aber eben auch Verschwörungstheorien, die solche Behauptungen aufgriffen. Zu sehen war das etwa bei der «Lab-Leak-These» über den Ursprung der Pandemie. Für diese gibt es keine haltbaren Belege. Laut aktuellem Stand der Forschung ist eine Übertragung des Coronavirus Sars-Cov-2 durch Wildtiere am wahrscheinlisten.
Journalismus, der dagegen anschreibt, wirkt
Wie können Medienschaffende also Verschwörungstheorien am besten eindämmen? Die Studie zeigt eindrücklich: Klarer Widerspruch gegen die Verschwörungsinhalte und Richtigstellen von Fakten – sogenanntes Debunking – sowie bewusstes Nichterwähnen einer Theorie sind bei der breiten Bevölkerung die besten Gegenmittel. Sanftes Widerlegen oder ausgewogene Berichterstattung verstärken dagegen den Verschwörungsglauben. Daher sollten Medien beispielsweise einfach den Fakt darlegen, dass Masken gegen Ansteckungen helfen, ohne dabei auf falsche Behauptungen aus Verschwörungstheorien einzugehen.
Diese Erkenntnis ist eine kleine Sensation. Tobias Rohrbach: «Journalistische Bemühungen, gegen Verschwörungstheorien anzuschreiben, reduzieren den Verschwörungsglauben. Wir konnten das zum ersten Mal anhand von Informationen aus tatsächlicher Mediennutzung im Feld zeigen und nicht nur im simulierten Experiment.»
«Wie kann man Verschwörungstheorien eindämmen, bevor sie sich in der Öffentlichkeit verbreiten?»
Tobias Rohrbach
2024 führte das Team des IKMB ausserdem ein Experiment durch, um verschiedene journalistische Strategien und deren Wirkung, abhängig von der individuellen Einstellung einer Person zu analysieren.
Menschen mit «Verschwörungsmentalität» sind demnach am schwierigsten zu erreichen. Bei ihnen wurde ein «Backfire-Effekt» festgestellt: Sie glauben erst recht an eine Verschwörungstheorie, wenn Medien diese ignorieren oder deutlich widerlegen.
Mehr Ressourcen für Medienschaffende
In einem Workshop stellten die Forschenden im Mai 2025 die Ergebnisse einer Gruppe von Journalistinnen und Journalisten vor. Einige würden aus heutiger Sicht kompromissloser Verschwörungstheorien widerlegen oder nicht darüber berichten, sagt zusammenfassend Tobias Rohrbach. «Der Konkurrenzdruck und die Verunsicherung in der Krise haben hier mitgespielt.»
Der Teilnehmer Lukas Lippert, Redaktor beim «Beobachter», sah sich bestärkt: «Wir wägen zwar immer ab und hintersinnen uns, bevor wir über solche Themen berichten. Es war aber gut, nochmals in aller Deutlichkeit und empirisch gestützt zu hören, dass es funktioniert.»
«So einen detaillierten Einblick in Daten zu bekommen und diese zu diskutieren, passiert viel zu selten.»
Lukas Lippert
Am kontroversesten diskutierte die Runde, ob und wie man Verschwörungsanhängerinnen und -anhänger erreichen soll, die sich vor allem auf alternativen und extremen Plattformen bewegen. Ein Vorschlag war, dass Journalistinnen und Journalisten aktiver auf Blogs und auf Social Media mitdebattieren. Doch den Medien müsse man auch mehr strukturelle Ressourcen zugestehen, wenn sie bei der Bekämpfung von Verschwörungstheorien mehr Verantwortung übernehmen sollten, findet Tobias Rohrbach.
Gegenseitiger Gewinn
Den engen Austausch zwischen Medien und Wissenschaft schätzt der Journalist Lukas Lippert: «Wir erhielten einen spannenden, detaillierten Einblick in die Daten und Methoden und diskutierten diese im kleinen Rahmen. Das passiert viel zu selten.» Tobias Rohrbach stimmt zu: «Wir sollten das kritische Feedback der Praxis öfter abholen. Es erhöht die Glaubwürdigkeit unserer Befunde», sagt er.

Den Workshop veranstalteten die Forschenden ausserdem, um auf neue Forschungsfragen aus dem Berufsfeld zu stossen. Sie erfuhren, was die Branche gerade besonders beschäftigt, etwa der Einsatz von KI-Faktencheck-Tools.
Die Resonanz beider Seiten war so gut, dass das Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft solche Workshops mit Medienschaffenden in künftigen Studien systematisch von Beginn an als Methode einbeziehen wird.
Zur Person

Tobias Rohrbach ist Postdoc am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft (IKMB) der Universität Bern. Er forscht vor allem zu Gender, politischer Kommunikation und Prozesse des digitalen Journalismus.
uniAKTUELL-Newsletter abonnieren
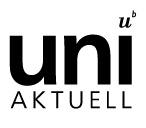
Entdecken Sie Geschichten rund um die Universität Bern und die Menschen dahinter.


