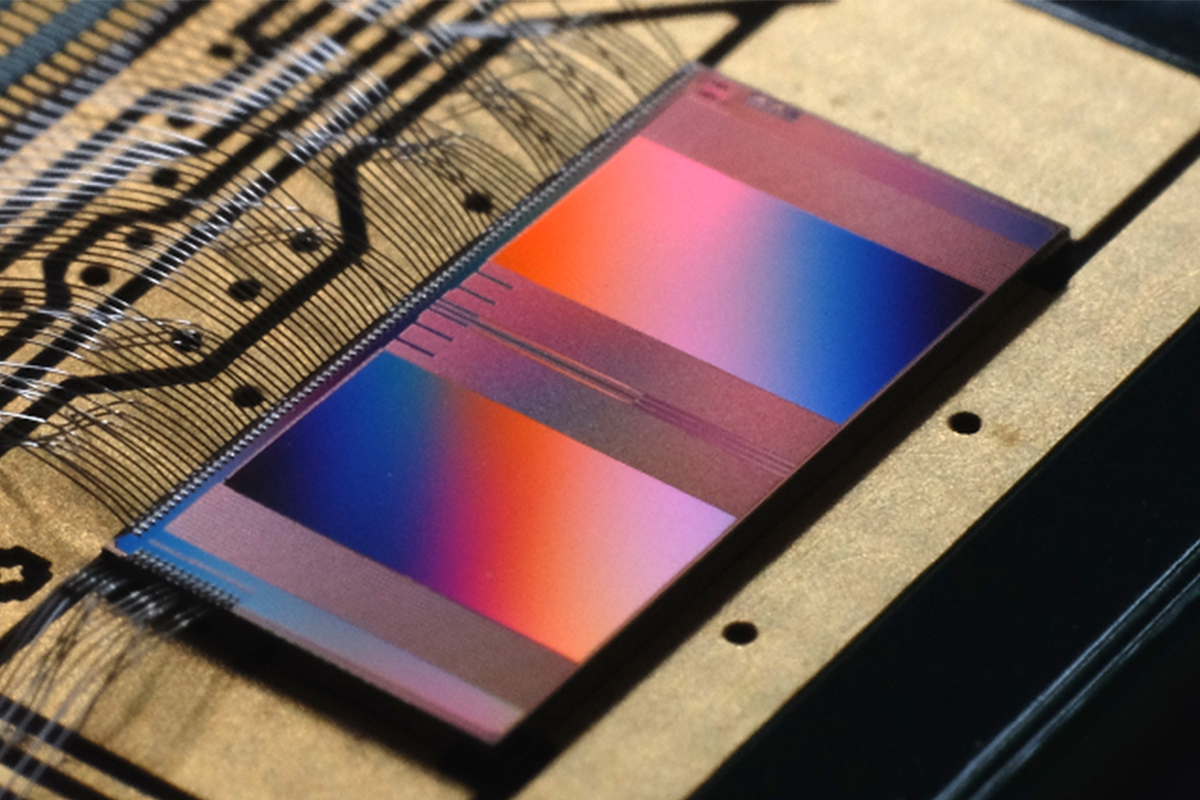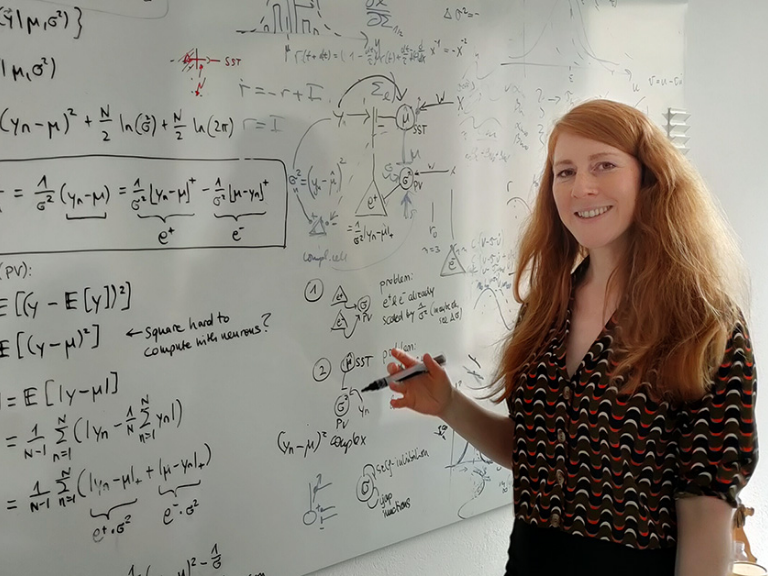Gehirngesundheit
So bleiben unsere grauen Zellen gesund
Fisch essen beugt Demenz vor, Gehirntraining-Apps machen uns klüger, und das Handy schadet der Hirnentwicklung von Kindern – rund um unser Denkorgan ranken sich zahlreiche Mythen. Was ist daran wahr? Auskunft von einer Expertin und einem Experten aus Bern.

Ein gesundes Gehirn ist wichtig – nicht nur für unser geistiges Wohlbefinden. Auch das körperliche, soziale und spirituelle Wohlbefinden hängen von unserem Denkorgan und seiner Gesundheit ab. Gesunde und leistungsfähige Köpfe tragen letztlich massgeblich zum Wohlstand eines Landes bei. Doch die Gehirngesundheit ist immer stärker in Gefahr. Darauf weisen Fachpersonen auf der ganzen Welt hin.
«Auch bei uns in der Schweiz sind Hirnerkrankungen wie Kopfschmerzen, Depressionen, Demenzen, Schlafprobleme und Angststörungen sehr weit verbreitet», sagt Claudio Bassetti, Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Bern. «In Europa verursachen die mit den oft langwierigen Erkrankungen verbundenen Ausfälle und Behandlungen jährliche Kosten in der Höhe von rund 800 Milliarden Euro», fügt Kristina Adorjan hinzu, Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitären Psychiatrischen Dienste (UPD) in Bern.
Schätzungen zufolge sind mehr als 50 Prozent der hiesigen Bevölkerung von mindestens einer Hirnerkrankung betroffen. Tendenz stark steigend, insbesondere nach der Corona-Pandemie. 2023 haben Bassetti und Adorjan gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Schweiz eine nationale Strategie ausgearbeitet, um die Bevölkerung auf Gehirngesundheit zu sensibilisieren und die Prävention zu stärken (siehe Infobox «Swiss Brain Health Plan»).
«Obwohl neurologische und psychiatrische Erkrankungen weit mehr Leiden und Kosten verursachen als etwa Herz-Kreislauf- oder Krebserkrankungen, war das Gehirn in bisherigen nationalen Gesundheitsstrategien kein Thema», sagt Bassetti. Auch aufgrund der grossen Fortschritte im Verständnis der Mechanismen der Hirnerkrankungen gebe es sehr gute Gründe, hier aktiv zu werden.
«Weil viele fälschlicherweise davon ausgehen, dass man nichts für den Erhalt der Gehirngesundheit machen kann, wird vorbeugenden Massnahmen noch viel zu wenig Beachtung geschenkt», findet Bassetti. Gleichzeitig macht sich ein Teil der Bevölkerung Sorgen um ihre Hirngesundheit, denn um das Thema ranken sich zahlreiche Mythen. Hier antworten Bassetti und Adorjan auf fünf oft gehörte Behauptungen – und ordnen ein, was jeweils davon zu halten ist.
Omega-3-Fettsäuren fördern die Hirnleistung und beugen Demenz vor.
«Dass Fisch und andere Lebensmittel mit viel Omega-3-Fettsäuren (wie etwa Leinöl oder Nüsse und Samen) kognitive Funktionen unterstützen und erhalten können, ist in der wissenschaftlichen Literatur gut belegt», sagt Adorjan. Allerdings hänge die Gehirngesundheit von vielen verschiedenen Faktoren ab, eine gesunde Ernährung sei nur einer davon.
In den Medien kursieren viele Schlagzeilen, die dieser Komplexität nicht gerecht werden. «Es ist gesund, Fisch zu essen», betont Bassetti. «Aber es soll niemand denken, dass er garantiert keine Demenz entwickelt, wenn er ab jetzt nur noch Fisch isst.»
Wenn ich mich bewege, hilft das meinem Gehirn.
«Körperliche Aktivität tut gut, auch der Psyche», sagt Bassetti. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt Erwachsenen, sich während 150 bis 300 Minuten pro Woche körperlich zu betätigen. Weniger Bewegung ist ungesund, genauso wie langes Sitzen, das man am besten immer wieder durch kurze Aufstehpausen unterbrechen sollte.
Dass sich Bewegung positiv auf unser Denkorgan auswirkt, hat damit zu tun, dass der Blutkreislauf stimuliert wird, wenn wir körperlich aktiv sind. So wird das Gehirn ausreichend mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt. Zudem zeigen mehrere Untersuchungen auf, dass Bewegung entzündliche Prozesse im Gehirn verringern kann.
«Man kann mit dem Lebensstil, den man wählt, die eigene Gehirngesundheit fördern und schützen. Das ist eine positive Botschaft», sagt Bassetti. Neben gesunder Ernährung, genügend Bewegung, geistigen Aktivitäten und sozialen Kontakten sei es auch wichtig, für ausreichenden Schlaf zu sorgen: «Es ist sehr gut belegt, dass ein erholsamer Schlaf auf vielen Ebenen – nicht nur für das Gehirn, auch für den Körper – wohltuend ist.» Allerdings finde der Schlaf in der Gesundheitsförderung zu wenig Beachtung. «Diese Lücke gilt es zu schliessen», sagt Bassetti.
«Es ist wichtig, für ausreichenden Schlaf zu sorgen. Das wird noch zu oft vernachlässigt.»
- Claudio Bassetti
Gehirntraining-Apps machen uns messbar klüger.
«Wir haben bei Studien mit Patientinnen und Patienten, die an Long-Covid leiden, tatsächlich gesehen, dass sich die geistige Leistungsfähigkeit mit Online-Trainingsmethoden erhöhen lässt», sagt Adorjan.
Sie und Bassetti legen jedoch Wert auf die Feststellung, dass es nicht unbedingt digitale Apps sein müssen. «Einige halten sich auch mit dem Lösen von Kreuzworträtseln aus der Zeitung geistig fit», sagt Adorjan. «Viele schwören auf Sudoku», fügt Bassetti hinzu. Es sei jedoch wichtig, das Gehirn nicht nur «allein im dunklen Kämmerlein» zu trainieren. Er empfiehlt, auch soziale Kontakte zu pflegen. Sich also zum Beispiel mit Freunden und Bekannten zu treffen – und mit ihnen zu diskutieren.
Digitale Medien schaden der Hirnentwicklung von Kindern und Jugendlichen.
«Das ist eine zu starke Aussage», antwortet Adorjan. Es gebe zum Beispiel digitale Lernprogramme, die sehr nützlich und erfolgreich seien. «Es kommt auf das Alter an – und darauf, wie intensiv die digitalen Medien genutzt werden. Zurückhaltung ist besonders bei kleinen Kindern und Jugendlichen angezeigt», sagt die Psychiaterin. «Die sollen sich lieber beim gemeinsamen Spielen austoben als sitzend und bewegungslos in den Bildschirm zu starren», meint Bassetti.
Einige Jugendliche hätten keine Probleme mit der Nutzung, andere bekundeten jedoch Schwierigkeiten. Bei übermässigem Konsum besteht die Gefahr, ein Suchtverhalten zu entwickeln, gibt Adorjan zu bedenken. Zudem könnten sich Schlafstörungen entwickeln. «Der Schlafmangel wirkt sich wiederum negativ auf die Aufnahmefähigkeit und das Gedächtnis aus.»
«Es kommt auf das Alter an – und darauf, wie intensiv die digitalen Medien genutzt werden. Zurückhaltung ist besonders bei kleinen Kindern und Jugendlichen angezeigt.»
- Kristina Adorjan
Depression hinterlässt bleibende Hirnschäden.
Die Wissenschaft habe in den letzten Jahrzehnten gelernt, dass Depression nicht nur eine seelische Erkrankung sei, sondern auch eine des Gehirns, so Adorjan. Bei Menschen mit Depression finde man Veränderungen auf Ebene der Hirnbotenstoffe, der sogenannten Neurotransmitter. «Wenn sich die Spiegel von Serotonin und anderen Neurotransmittern im Ungleichgewicht befinden, wirkt sich das auf die Emotionen, die Stimmung und den Antrieb aus», sagt Adorjan.
Bleiben Depressionen lange unbehandelt, könne sich das auch in der Gehirnstruktur zeigen, besonders in gewissen Gehirnarealen wie etwa im Hippocampus oder im präfrontalen Kortex. Trotzdem würden weder Adorjan noch Bassetti von «bleibenden Hirnschäden» reden. Denn die veränderten Gehirnstrukturen könnten sich nach einer geeigneten Behandlung – also Psychotherapie, Medikamente, Bewegung und soziale Unterstützung – wieder zurückbilden. Der Begriff sei also überzogen – und drohe, das mit psychischen Leiden verbundene Stigma zu verstärken, statt es abzubauen. «Der Swiss Brain Health Plan soll auch dazu beitragen, dass wir in Zukunft möglichst nüchtern und vorurteilsfrei über Gehirngesundheit sprechen können», sagt Bassetti.
Infobox
Swiss Brain Health Plan
Der Plan für die Gehirngesundheit in der Schweiz ist in Anlehnung an die Brain Health Strategy der WHO erarbeitet worden. Er ergänzt Bestrebungen auf europäischer Ebene und vereint Fachkräfte aus Neurologie, Psychiatrie, Pädiatrie, Neurowissenschaften, Präventivmedizin und der Ökonomie. «Zentral ist auch die Mitwirkung von Betroffenen und Angehörigen», sagt Claudio Bassetti. Das Ziel ist ein schweizweites Zusammenspannen, um ein breites und ganzheitliches Verständnis der Gehirngesundheit zu entwickeln.
Der Swiss Brain Health Plan definiert fünf strategische Themenfelder, die von der Sensibilisierung und Gesundheitsförderung über Forschung und Ausbildung bis zur Stärkung der Patientinnen und Patienten reichen.
An der Universität Bern ist im Rahmen des Plans eine neue Weiterbildung entstanden: das «Certificate of Advanced Studies in Brain Health». «Der Studiengang ist weltweit einzigartig», sagt Bassetti. «Er soll eine neue Generation von Fachkräften heranbilden, die sich auf die Gesundheit des Gehirns spezialisiert haben – und der Gesellschaft helfen, sich für die erwartbaren Herausforderungen zu wappnen.»
Mehr Informationen zur Weiterbildung (nur auf Englisch)
Zur Person

Claudio Bassetti ist Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Bern und Chair des Swiss Brain Health Plans. Zuvor war er Direktor der Universitätsklinik für Neurologie am Inselspital. Sein Hauptinteresse in der Forschung gilt den Beziehungen zwischen Schlaf und Gehirn.
Zur Person

Kristina Adorjan ist Direktorin der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitären Psychiatrischen Dienste (UPD). An der Universität Bern hat sie zudem den Lehrstuhl für Psychiatrie und Psychotherapie inne. Ihr Forschungsinteresse ist thematisch dreigeteilt: Global Mental Health, psychiatrische Genetik und Versorgungsforschung.