Sozial- und Präventivmedizin
Sex und Gender: Der Weg zu einer besseren Medizin
Angèle Gayet-Ageron, Direktorin des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin (ISPM) der Universität Bern erklärt, warum das biologische und soziale Geschlecht in der medizinischen Forschung systematisch berücksichtigt werden muss.

Sie haben kürzlich einen Kommentar im renommierten Fachmagazin Lancet mitverfasst. Darin betonen Sie die Bedeutung von biologischem und sozialem Geschlecht – englisch «Sex» und «Gender» – in der medizinischen Forschung. Seit wann und warum engagieren Sie sich für dieses Thema?
Angèle Gayet-Ageron: Mein Interesse für diese Fragen begann während meines Medizinstudiums Ende der 90er-Jahre, als die kombinierten Therapien gegen HIV aufkamen. Im Spital sah ich damals viele Menschen mit Aids, die sich in einem sehr schlechten Zustand befanden: Die Krankheit war noch kaum behandelbar, viele Betroffene verstarben. Aids war in der Wahrnehmung auch sehr stark mit der homosexuellen Community verknüpft, die Diskriminierung war entsprechend gross. Das hat mich aufgerüttelt und mich früh für Fragen von Diskriminierung und Ungleichheit in der Medizin sensibilisiert.
Sex und Gender beeinflussen unsere Gesundheit enorm: angefangen bei den Gesundheitsrisiken, über die Ausprägung und den Verlauf von Krankheiten bis hin zur Wahrnehmung durch das Gesundheitspersonal. All das hat einen grossen Einfluss auf den Zugang zur Gesundheitsversorgung.
Wie genau definieren Sie Sex und Gender im medizinischen Kontext?
Sex ist das biologische Geschlecht und hat mit den Sexualchromosomen zu tun: Frauen haben üblicherweise XX, Männer XY, aber es gibt viele Variationen. Diese Chromosomen beeinflussen unsere Hormone, und diese wiederum beeinflussen Stoffwechselreaktionen, das Herz-Kreislauf-System, den Blutdruck, die Stimmung, Medikamentenwirkungen, -Nebenwirkungen und vieles mehr. Die Biologie hat reale Auswirkungen auf unsere Gesundheit.
Und Gender?
Gender ist das soziale Geschlecht oder ein gesellschaftliches Konstrukt von Geschlechtern. Man kann ein biologisches Geschlecht haben, zum Beispiel weiblich, aber die Geschlechtsidentität kann davon abweichen und mehr oder weniger feminin, mehr oder weniger maskulin sein oder keine davon. Die Geschlechtsausdrucksform – also wie man sich präsentiert – kann ebenfalls stark variieren.
«Eine gute Medizin für alle ist nur möglich, wenn Sex und Gender von Anfang an in der Forschung berücksichtigt werden.»
- Angèle Gayet-Ageron
Leider herrscht um den Begriff «Gender» grosse Verwirrung: Er wird oft allein auf die sexuelle Orientierung oder auf Transidentität reduziert und stark politisiert.
Das Ganze ist komplex, aber in medizinischen Studien kann man Sex und Gender oftmals mit zwei einfachen Fragen erfassen: Welches Geschlecht wurde Ihnen bei der Geburt zugewiesen? Und wie identifizieren Sie sich selbst? Für einige Studien sind detailliertere Daten nötig – etwa Hormonwerte oder Chromosomenanalysen. Aber das Entscheidende ist, früh über die Fragestellung nachzudenken und was wir damit herausfinden möchten.
Können Sie konkrete Beispiele geben, warum es wichtig ist, das Geschlecht in der medizinischen Forschung zu berücksichtigen?
Ein klassisches Beispiel ist das Schlafmittel Zolpidem. Das Geschlecht wurde in den vorangehenden klinischen Studien nicht ausreichend berücksichtigt, bei der Zulassung wurde nur eine Dosis für alle angegeben. Später stellte man fest, dass diese Dosis für Frauen viel zu hoch war: Weil sie das Medikament langsamer abbauen, kann die Wirkung bei ihnen bis zum nächsten Morgen anhalten und dann zum Beispiel ihre Leistungsfähigkeit verringern oder sie beim Autofahren gefährden. Wären die statistischen Analysen der klinischen Studien nach dem Geschlecht der Teilnehmenden dargestellt worden, hätten viele schwere oder sogar tödliche Unfälle von Frauen vermieden werden können.
«Sex und Gender sind keine Ideologie, sondern zentrale Faktoren für wissenschaftliche Genauigkeit und die Sicherheit von Patienten und Patientinnen.»
- Angèle Gayet-Ageron
Ein zweites Beispiel ist der Herzinfarkt. Während meines Medizinstudiums habe ich noch gelernt, dass vorwiegend übergewichtige, gestresste Männer ab 50 davon betroffen sind, und dass man ihn an Schmerz in der Brust erkennt, der in die Arme und in den Kiefer ausstrahlen kann. Bei Frauen sind die Symptome aber oft ganz anders: Übelkeit, Bauchschmerzen, Schwindel, Müdigkeit. Zu lange wurden daher viele Frauen falsch oder zu spät diagnostiziert und sind daran gestorben.
Und inwiefern ist Gender aus medizinischer Sicht relevant?
In vielen Studien sieht man, dass Frauen im medizinischen Alltag weniger ernst genommen, ihre Schmerzen unterschätzt werden. Kamen Frauen mit Brustschmerzen in die Notaufnahme, wurde über Jahre hinweg häufig Angst als Ursache vermutet anstelle einer Herzerkrankung.
Ein weiteres Gender-Problem in der Medizin ist, dass Krankheiten, die hauptsächlich Frauen betreffen, weniger Priorität bekommen, weniger Forschungsfinanzierung und weniger Aufmerksamkeit. Ein Beispiel ist Endometriose: Weltweit leiden Millionen von Frauen darunter. Dennoch wurde sie über Jahrzehnte kaum erforscht. Das medizinische Wissen blieb entsprechend lückenhaft. Betroffene lebten jahrelang mit starken Schmerzen, bevor sie eine Diagnose und angemessene Behandlung erhielten. Ernst genommen wird Endometriose erst, seit deutlich wurde, dass sie die Chancen auf eine Schwangerschaft verringern kann.
Wenn es derart wichtig ist: Warum werden Sex und Gender in der Forschung noch immer nicht ausreichend berücksichtigt?
Die medizinische Forschung ist in weiten Teilen noch immer nicht ausreichend inklusiv. In den letzten Jahren ist zwar schon einiges passiert: 2016 veröffentlichte eine internationale Gruppe von Expertinnen und Experten die SAGER-Richtlinien zur besseren Integration von Sex und Gender-Gerechtigkeit in der medizinischen Forschung.
Das war zwar ein Meilenstein, aber diese Guidelines richten sich vor allem an Personen, die Fachzeitschriften herausgeben, um bereits eingereichte Forschungsartikel im Hinblick auf Sex- und Gender-Gerechtigkeit zu bewerten. Das ist aber viel zu spät im Prozess! Denn wenn Forschende nicht von Anfang an daran gedacht haben, geschlechtsspezifische Daten zu erheben, können sie nachträglich auch keine solchen analysieren.
War das der Grund, warum Sie für die Schweiz entsprechende SAGER-Richtlinien mit erarbeitet haben, die sich an Ethikkommissionen richten?
Ja. 2023 haben wir eine Arbeitsgruppe geschaffen und die SAGER-Empfehlungen für Schweizer Ethikkommissionen angepasst. Kernstück ist eine Checkliste, die Forschende und dann auch Ethikkommissionen nutzen können, um systematisch zu prüfen, dass Sex und Gender in einer geplanten Studie überall berücksichtigt werden, wo es notwendig ist. In einem Forschungsprojekt im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms NFP 83 zu Gendermedizin und -gesundheit werden wir nun untersuchen, ob die neuen Richtlinien in der Praxis tatsächlich dazu führen, dass Schweizer Ethikkommissionen und Forschende Sex und Gender stärker berücksichtigen.
uniAKTUELL-Newsletter abonnieren
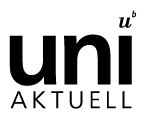
Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.
Können Sie ein Beispiel geben für wichtige Punkte, die bisher in vielen Forschungsprojekten vergessen gehen?
Bei der Prüfung eines Forschungsprotokolls schaue ich mir zum Beispiel immer an, wie die Rekrutierung geplant ist. Wenn Untersuchungen oder Befragungen nur am Mittwochnachmittag geplant sind, werden eher Frauen ohne Kinder teilnehmen können, aber kaum Mütter, die kleine Kinder betreuen. Hinzu kommt, dass Schwangere oder Frauen im gebärfähigen Alter teils noch immer systematisch ausgeschlossen werden.
Häufig ist Forschenden schlicht nicht bewusst, warum Sex und Gender eine Rolle spielen. Viele machen vor Studienbeginn keine gründliche Literaturrecherche zum Thema. Dabei müsste man sich fragen: Spielen Sex oder Gender bei dieser Krankheit oder Fragestellung eine Rolle? Wer für das Thema nicht sensibilisiert ist, baut die Studie automatisch so auf, dass diese Informationen am Ende fehlen.
Sie haben lange am Universitätsspital und an der Universität Genf gearbeitet und sich dort stark zum Thema engagiert, zum Beispiel eine Gruppe «Medizin, Gender und Gleichstellung» mitgegründet. Seit April sind Sie nun Direktorin des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern. Wie erleben Sie das Umfeld an der Universität Bern im Vergleich zu Genf?
Sehr positiv. Das Netzwerk «Female Empowerment in Life Sciences» FELS bringt Forscherinnen aus Medizin und Biologie auf verschiedenen Karrierestufen zusammen, damit sie einander unterstützen können. Auch die Gleichstellungskommission ist sehr aktiv. Und die Schaffung einer neuen Professur für Gendermedizin an der Universität Bern ist ein starkes Signal, dass das Thema ernst genommen wird.
Was wir in Bern noch entwickeln könnten, ist eine systematischere Integration von Sex und Gender in die medizinische Ausbildung. Lausanne und Genf sind in diesem Bereich sehr aktiv. Wir könnten vom Netzwerk profitieren, das ich in Genf aufgebaut habe, um dasselbe auch hier in Bern umzusetzen. In meinen eigenen Kursen baue ich diese Aspekte bereits regelmässig ein. Gemeinsam mit der Professorin für Gendermedizin möchte ich das künftig noch breiter verankern.
In Ihrem jüngsten Lancet-Kommentar betonen Sie, dass es angesichts der aktuellen politischen Lage besonders wichtig ist, sich für das Thema einzusetzen. Warum?
Mit einem amerikanischen Präsidenten, der diese Fragen verbietet und die Finanzierung für Forschung zu Gender streicht, erleben wir einen gravierenden Rückschritt. Und ich habe den Eindruck, dass sich auch hier in der Schweiz manche Personen, die zuvor geschwiegen haben, jetzt plötzlich ermutigt fühlen, sich gegen diese Themen auszusprechen und Sex- und Genderfragen als eine rein politische Angelegenheit abzutun.
Doch das ist grundfalsch: Es geht nicht um Ideologie. Es geht um Gerechtigkeit, um wissenschaftliche Genauigkeit und die Relevanz von Forschungsergebnissen sowie um eine sichere medizinische Versorgung für alle Menschen – egal, ob sie sich als Frau, Mann oder nicht-binär identifizieren. Wenn wir Sex und Gender ignorieren, verschlechtern wir Diagnosen, verpassen Behandlungen und gefährden Patientinnen und Patienten. Nicht zuletzt setzen wir auch das Vertrauen der Gesellschaft in die Wissenschaft aufs Spiel. Gerade deshalb müssen wir heute entschlossener denn je dafür eintreten.
Zur Person

Prof. Dr. Angèle Gayet-Ageron
ist seit April 2025 Direktorin des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin ISPM der Universität Bern. Geboren 1975 in Frankreich, schloss sie 1999 ihr Medizinstudium an der Universität Nancy ab und spezialisierte sich an den Universitäten Lyon, Paris und Bordeaux auf Epidemiologie und Public Health. Bevor sie nach Bern kam, war sie über zwei Jahrzehnte am Universitätsspital Genf tätig – zunächst in der Abteilung HIV-AIDS, ab 2008 in der klinischen Epidemiologie.
Neue SAGER-Richtlinien für Schweizer Ethikkommissionen
Prof. Angèle Gayet-Ageron war massgeblich beteiligt an der Erarbeitung neuer SAGER-Richtlinien für die Schweizer Ethikkommissionen. 2024 publiziert, sollen sie gewährleisten, dass Sex und Gender in geplanten Forschungsprojekten bereits von Anfang an systematisch berücksichtigt werden: vom Studiendesign über die Auswahl von Studienteilnehmenden bis zur Analyse der Ergebnisse. Dadurch sollen die Genauigkeit, Relevanz und Fairness wissenschaftlicher Ergebnisse verbessert werden.


