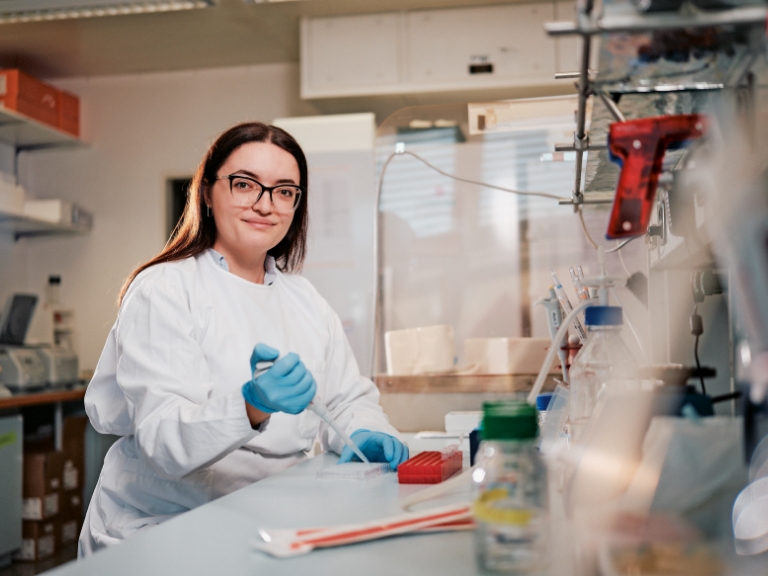20 Jahre GCB
Nachwuchsförderung in der Biomedizin
Zwei Forschungsprojekte der Graduate School for Cellular and Biomedical Science (GCB) zeigen exemplarisch, wie wissenschaftliche Neugier, klinische Relevanz und gesellschaftlicher Nutzen zusammenfinden – und wie Forschungskarrieren erfolgreich starten können.

Vor zwanzig Jahren wurde die Graduate School for Cellular and Biomedical Sciences (GCB) gegründet – sie ist damit die älteste von insgesamt acht Graduate Schools der Universität Bern. Diese sind auf akademische Studiengänge spezialisiert, die den Doktortitel zum Ziel haben. «Der Fokus der GCB liegt auf Forschung in den zellulären und biomedizinischen Wissenschaften wie beispielsweise der Biochemie, Immunologie oder Neurobiologie», erklärt deren Koordinatorin Monica Schaller. «Zu den Stärken unserer Graduate School gehört nicht nur die enge Verbindung zwischen Naturwissenschaften, Medizin und Veterinärmedizin, sondern auch unser Betreuungssystem.»
Ebenso prägend für die GCB ist deren internationale Ausrichtung und das umfangreiche Kursangebot für Doktorierende. Nebst technischen Fähigkeiten sollen den Absolventinnen und Absolventen auch praxisrelevante Fertigkeiten vermittelt werden – etwa wissenschaftliches Schreiben.
Internationale Kooperationen
Seit ihrem Bestehen ist die GCB kontinuierlich gewachsen: Während man 2006 erst 45 Doktorierende zählte, sind es mittlerweile 549 – aus über 40 Ländern. «Diese Entwicklung hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass unser Doktoratsprogramm für internationale Kooperationen attraktiv ist», so Schaller.
Die Doktorierenden stammen aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen: «Es lassen sich dabei keine klaren Tendenzen erkennen – an der GCB sind alle Bereiche gleichermassen vertreten, von den biomedizinischen Grundlagen bis zur klinischen Forschung.» Schaller versteht die Einrichtung insbesondere als Nachwuchsförderung: «Unser Programm fördert eine umfassende wissenschaftliche Kompetenz kombiniert mit fachlicher Spezialisierung. Und genau das macht unsere Absolventinnen und Absolventen international konkurrenzfähig.»
«Unser Programm fördert eine umfassende wissenschaftliche Kompetenz – kombiniert mit fachlicher Spezialisierung.»
- Monica Schaller
Schaller zeigt sich überzeugt, dass Themen wie personalisierte Medizin, Biotechnologie und Künstliche Intelligenz in der Biomedizin in den nächsten 20 Jahren zunehmend wichtiger werden. «Die GCB kann hier als Schnittstelle zwischen medizinischem Fortschritt und Gesundheitsforschung dienen, indem sie Doktorierende optimal für die Herausforderungen der Zukunft ausbildet.» Aus ihrer Sicht ist es in der Forschung wichtig, möglichst viele Perspektiven in ein Projekt einzubringen. «Unsere vorgegebene Betreuungsstruktur aus drei Personen hat zum Ziel, hinreichend wissenschaftliche Unterstützung anzubieten, damit eine Doktorarbeit innert drei bis vier Jahren abgeschlossen werden kann.»
Von der Luftfahrt- bis zur Biomedizintechnik
Wie dies in der Praxis gelingen kann, zeigen zwei aktuelle Beispiele: Karoline-Marie Bornemann und Lucilla Giammarino sind jeweils mit dem GCB Best Thesis Award 2024 ausgezeichnet worden. Bornemann, die 2020 ihren Dipl.-Ing. in Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität Dresden erwarb, entschied sich – nach dem Hören eines Vortrages über Biofluid-Dynamik – für einen Wechsel in die Biomedizintechnik.
Sie bewarb sich für ein Doktorat am ARTORG Center for Biomedical Engineering Research. Dieses ist an die Universität Bern angeschlossen und entwickelt Technologien für Diagnose, Monitoring, Therapie und Rehabilitation in der Biomedizin.
«Ich habe mich schon immer für Strömungsmechanik und Turbulenzen interessiert», erklärt sie. «Interessanterweise ist die Aortenklappe der einzige Ort im menschlichen Körper, an dem die Blutströmung tatsächlich turbulent werden kann.» Diese Entdeckung führte sie zum Thema ihrer Doktorarbeit. Darin hat sie erforscht, wie und weshalb der normalerweise gleichmässige Blutfluss an einer künstlichen Herzklappe turbulent wird – was die Entstehung von Blutgerinnseln und Thrombosen begünstigen kann.
Breite Unterstützung, wenig Konkurrenzdruck
Neben ihrem Hauptbetreuer wurde Karoline-Marie Bornemann von zwei weiteren Personen unterstützt. «An der GCB habe ich jährlich einen Fortschrittsbericht eingereicht, um zu dokumentieren, wie mein Projekt vorankommt», erzählt sie. Insgesamt verbrachte Bornemann vier Jahre an der Universität Bern. «Ich habe mein Projekt geliebt. Besonders geschätzt habe ich die unterstützende Atmosphäre – weder am ARTORG noch an der GCB oder in meiner Forschungsgruppe war Konkurrenz ein Thema.»
«Ich wollte herausfinden, warum und unter welchen Bedingungen Blutströmung turbulent werden kann.»
- Karoline-Marie Bornemann
2020, im selben Jahr wie Bornemann, begann auch Lucilla Giammarino ihr Doktorat an der GCB. «Meine Forschung drehte sich um geschlechtsspezifische Unterschiede bei der elektrischen Funktion der oberen Herzkammern, also der Vorhöfe», erklärt Giammarino. Ziel war es, besser zu verstehen, warum diese Herzkammern häufig von Vorhofflimmern betroffen sind – einer weit verbreiteten Herzrhythmusstörung. «Wir konnten zeigen, dass die Vorhöfe bestimmte Eigenschaften aufweisen, die bei Frauen und Männern unterschiedlich ausgeprägt sind und die Anfälligkeit für Vorhofflimmern beeinflussen.» Dieser Befund werde auch von neuen Studien bestätigt.
«Ich wollte zur Verbesserung der Patientenversorgung beitragen – und somit zu einem gesellschaftlichen Nutzen.»
- Lucilla Giammarino
«Wissenschaftliche Neugier war während meiner gesamten Doktorarbeit eine wichtige Triebfeder», betont sie. Wichtig war Lucilla Giammarino auch die klinische Relevanz ihrer Forschung: «Ich wollte zur Verbesserung der Patientenversorgung beitragen – und damit einen gesellschaftlichen Nutzen erwirken.» Und wie blickt Giammarino auf ihre rund drei Jahre an der GCB zurück? «Der multidisziplinäre Ansatz hat meinen Horizont erweitert – unter anderem, weil ich viele Kurse ausserhalb meines Hauptforschungsgebiets besucht habe», bilanziert sie.
Ihr Supervisor und ihre Mentorin hätten sie zudem dazu ermutigt, die Forschungsergebnisse so zu kommunizieren, dass sie auch für ein breiteres Publikum verständlich sind. «Veranstaltungen wie das jährlich stattfindende GCB-Symposium, das einerseits Forschungsergebnisse der Doktorierenden präsentiert und andererseits eine Plattform für Diskussionen und Networking bietet, haben uns ebenfalls dazu angeregt, über unsere Komfortzone hinauszudenken.»
Für beide Forscherinnen ist die Auszeichnung mit dem GCB Best Thesis Award 2024 von grosser Bedeutung. Karoline-Marie Bornemann spricht von einer «Anerkennung für die geleistete Arbeit und Ansporn für Neues», während Lucilla Giammarino betont: «Die Auszeichnung motiviert mich, weiterhin bedeutungsvolle Forschung zu betreiben.»
Und wie kommentiert GCB-Koordinatorin Monica Schaller den Erfolg der beiden? «Sie haben diese Auszeichnung absolut verdient – nicht zuletzt aufgrund ihrer Haltung. Beide sind sehr engagiert und wollen mit ihrer Forschung etwas bewirken.»
Die Graduate School for Cellular and Biomedical Sciences (GCB)
Die Graduate School for Cellular and Biomedical Sciences (GCB) ist eine interfakultäre Einheit der Universität Bern. Sie organisiert das PhD-Programm in den Bereichen Zellbiologie, Biomedizin und verwandten Fachgebieten. Die GCB wird von einer interfakultären Kommission geleitet und richtet sich an Absolventinnen und Absolventen der Naturwissenschaften, Medizin, Zahnmedizin, Veterinärmedizin, Pharmazie und teilweise auch der Ingenieurwissenschaften. Ziel ist eine fundierte Ausbildung in Theorie und Praxis der experimentellen Forschung.
Zur Person

Monica Schaller
absolvierte ihren MSc in Molekularbiologie und Ökologie an der Universität Fribourg und promovierte im Labor von Prof. Urs Nydegger am Universitätsspital Bern. Seit 2015 ist sie an der Medizinischen Fakultät als Immunhämatologin habilitiert. Sie leitet eine eigene Forschungsgruppe mit Schwerpunkt auf autoimmunen thrombotischen Erkrankungen und ist am Departement für Biomedizinische Forschung (DBMR) Teil des «Blutprogramms» der Hämatologie des Inselspitals Bern. Seit 2019 koordiniert sie zudem die GCB.
Zur Person

Karoline-Marie Bornemann
studierte Luft- und Raumfahrttechnik an der Technischen Universität Dresden und schloss 2020 als Dipl.-Ing. ab. Für ihr Doktorat wechselte sie an das ARTORG Center for Biomedical Engineering Research der Universität Bern, wo sie bei Prof. Dr. Dominik Obrist promovierte. Derzeit ist sie als Postdoktorandin an der Stanford University tätig. Dort forscht sie an der Simulation angeborener Herzklappenerkrankungen und chirurgischen Eingriffen bei Neugeborenen.
Zur Person

Lucilla Giammarino
erwarb ihren BSc in Biotechnologie an der Universität Bologna und 2020 dort auch ihren MSc in Pharmazeutischer Biotechnologie. Ihre Doktorarbeit verfasste sie – betreut von Prof. Dr. med. Katja Odening – am Inselspital, Universitätsspital Bern und der Universität Bern. Heute arbeitet sie als Postdoktorandin in Rochester (Minnesota), in einem der Mayo Clinic angegliederten Labor. Dort erforscht sie genetische und molekulare Mechanismen, die auf erbliche Herzrhythmusstörungen zurückzuführen sind.