Mobile Nutztierversorgung
Mit Tierärztinnen auf Stallvisite
Trächtigkeitskontrollen, Impfungen, kranke Kühe: Die der Vetsuisse-Fakultät angegliederte Nutztierpraxis Bern bringt veterinärmedizinische Grundversorgung auf Bauernhöfe der Region – und Studierenden eine praxisnahe Ausbildung.

Lea Christen zieht einen Einweghandschuh über ihre rechte Hand, ihren Arm und den Ärmel ihrer grauen Arbeitsschürze, die fast bis zu den Gummistiefeln hinunterreicht. Dann streicht sie Gleitcreme darauf und führt ihre Hand vorsichtig in die Scheide von Vulipa ein – einer knapp fünfjährigen Milchkuh auf einem Milchbetrieb in Rubigen bei Bern. Um dabei keine Verunreinigungen einzubringen, hat sie Vulipas Vulva vorher mit Jodseife gewaschen und vom Kot befreit. Nun bringt sie eine Handvoll klaren Schleims zum Vorschein, riecht daran und begutachtet ihn, während sie ihn zwischen den Fingern zu Fäden zieht. Danach greift sie ins Rektum der Kuh: Von hier aus kann sie Gebärmutter und Eierstöcke von Hand ertasten, bevor ein mobiles Ultraschallgerät zum Einsatz kommt. Sie soll bestimmen, in welcher Zyklusphase sich Vulipa gerade befindet – und wann sie wieder besamt werden kann.
Lernen im Stall, mitten im Alltag der Nutztiermedizin
Christen studiert im fünften Jahr Veterinärmedizin mit Schwerpunkt Nutztiere an der Vetsuisse-Fakultät der Universität Bern, und an diesem warmen Junimorgen ist sie mit zwei erfahrenen Tierärztinnen der Nutztierpraxis Bern (NTB) unterwegs: Evi Studer und Isabelle Rediger. Studer ist Leiterin der Nutztierpraxis, die 2023 an der Wiederkäuerklinik der Vetsuisse-Fakultät der Universität Bern ins Leben gerufen wurde. Rediger hilft seit Sommer 2024 jeden Donnerstag aus und wird demnächst ihr Pensum aufstocken: Die Nutztierpraxis Bern ist gut angelaufen, sodass Verstärkung nötig ist.

Während eines der Büros der NTB und das Medikamentenlager in einer lokalen Tierarztpraxis in Worb angesiedelt sind, ist das Herzstück der Nutztierpraxis ein Kombiwagen, der als mobile Fahrpraxis eingerichtet wurde. In einem Schubladenstock im Heck hat Studer von Einweghandschuhen, Desinfektionsmittel, Medikamenten, Impfstoffen, einfachen Labortests bis hin zu mobilen Ultraschallgeräten alles untergebracht, was nötig ist, um die Tierarztpraxis direkt auf den Bauernhof zu bringen. So kann diese zur medizinischen Grundversorgung von Nutztieren in der Region beitragen und gleichzeitig Tiermedizin-Studierenden wie Christen eine praxisnahe Ausbildung bieten. «Lass es doch direkt die Studentin machen, die lernt mehr beim Machen als beim Zuschauen!», sagte ein Landwirt einmal zu ihr, als es um eine medizinische Behandlung ging, die Studer vorführen wollte.
«Lass es doch direkt die Studentin machen, die lernt mehr beim Machen als beim Zuschauen!»
Peter Flury, Landwirt
«Am Tierspital sehen die Studierenden vor allem die komplizierten Fälle – Knochenbrüche, aufwendige Labordiagnostik, Operationen», erklärt Rediger. «Es ist cool, wenn man das während dem Studium sieht und vielleicht sogar mal mitoperieren darf. Aber es ist nicht das, was die Mehrheit der Studierenden später in ihrem Arbeitsalltag antreffen wird.» Was dort regelmässig ansteht, sind beispielsweise Zyklus- oder Trächtigkeitsuntersuchungen von Milchkühen, die Behandlung von Kühen mit Kalziummangel, Euter- oder Gebärmutterentzündungen nach einer Geburt oder das Enthornen von Kälbern. «Das sind alles Sachen, die wir ohne komplexe diagnostische Untersuchungen direkt auf den Höfen machen können», sagt Rediger. «Als Tierärztin bin ich oft allein mit den Bauern und dem Tier und muss vor Ort entscheiden, wie ich einem Tier am besten helfen kann – basierend auf dem, was ich sehe, höre, fühle und mit einfachen Hilfsmitteln herausfinde. Dazu ist viel Übung nötig: Übung, welche die Studierenden bei uns in der Nutztierpraxis erhalten.»
«Operationen sind nicht das, was die Mehrheit der Studierenden später in ihrem Arbeitsalltag antreffen wird.»
Isabelle Rediger
Eng verbunden mit Forschung und Lehre
Um gleichzeitig nah verbunden zu bleiben mit Forschung und Lehre an der Vetsuisse-Fakultät der Universität Bern, teilen sich Studer und Rediger auch ein Büro an der Wiederkäuerklinik im Tierspital im Länggassquartier. Dort stehen die beiden Tierärztinnen zusammen mit Christen am Morgen der Reportage Mitte Juni bereits um sieben Uhr morgens vor dem Monitor und besprechen, was sie erwartet: Zuerst Stallvisite bei zwei Milchbetrieben, bei denen sie jeden zweiten Donnerstag für Routinekontrollen hingehen. Dort stehen Zykluskontrollen bei mehreren Kühen an, die bald wieder besamt werden sollen. Zudem Kontrollen bei denjenigen Kühen, die besamt wurden, um festzustellen, ob sie trächtig sind. Und auch Kühe, die kürzlich ein Kalb zur Welt gebracht haben, werden kontrolliert: Wie ist ihr Gesundheitszustand? Bildet sich die Gebärmutter so zurück, wie sie sollte?

Im System ist jede Kuh der Betriebe erfasst, die regelmässig besucht werden – und jede Kuh, die einmal an der Wiederkäuerklinik in Behandlung war oder von der mobilen Nutztierpraxis besucht wurde. So können die drei Frauen Kuh für Kuh durchgehen, die sie besuchen werden: Vulipa, Waldburga, Sheela, Syra, Delia, Tita und viele mehr. Was ist die Vorgeschichte, welche Behandlungen haben sie bereits erhalten, was wird heute kontrolliert?
Routineuntersuchungen und Krankheitsbehandlungen
Nach dem Besuch der beiden Milchbetriebe, deren Kühe sie regelmässig kontrollieren, sind zudem Besuche auf zwei Höfen vorgesehen, die sich in den Tagen davor bei der Nutztierpraxis gemeldet haben. Und auf dem Praxistelefon könnten sich im Verlauf des Tages noch Tierhaltende melden, die einen Notfall haben.
Magazin uniFOKUS

«Ein Teil von Bern»
Dieser Artikel erschien erstmals in uniFOKUS, dem Printmagazin der Universität Bern. uniFOKUS beleuchtet viermal pro Jahr einen thematischen Schwerpunkt aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Aktuelles Fokusthema: «Ein Teil von Bern»
Um halb acht fahren die zwei Tierärztinnen und die Studentin los mit ihrer mobilen Praxis, und kurz nach acht Uhr steht Christen nun bei Vulipa im Stall und ertastet Gebärmutter und Eierstöcke. «Was spürst du?», fragt Rediger, die neben ihr steht, ebenfalls in Arbeitsschürze und Gummistiefeln. Die Studentin beschreibt, die Tierärztin stellt ein paar Nachfragen, bevor sie selbst einen Einweghandschuh überstreift und die Sonde des Ultraschallgeräts ins Rektum der Kuh einführt. Auf dem Bildschirm wird sichtbar, was Christen bereits ertastet hat: Auf einem Eierstock ist ein heranreifendes Ei, das aber noch nicht weiter fortgeschritten ist als bei der letzten Untersuchung vor zwei Wochen. Eine Spirale mit Hormon-Ummantelung, die der Bauer in ein paar Tagen wieder entfernen kann, soll den Zyklus wieder in Schwung bringen, sodass die Kuh nächste Woche besamt werden kann.

Im Laufe des Vormittags folgen zahlreiche weitere Untersuchungen: Zyklusbestimmungen, Trächtigkeitskontrollen, die Behandlung einer Kuh mit auffälligem Vaginalausfluss und verzögerter Rückbildung der Gebärmutter nach der Geburt eines Kalbes. Weil es jeweils viele Tiere zu untersuchen gibt, arbeiten Studer, Rediger und Christen manchmal parallel und jede für sich, manchmal Schulter an Schulter gemeinsam.
Üben, beobachten, Verantwortung übernehmen
Wo immer möglich, übernimmt Christen die praktische Arbeit: Sie untersucht Kühe, ertastet Organe und verabreicht Spritzen. Eine Arbeit, die ihr gefällt, wie sie auf der Autofahrt erklärt. «Ich kann mir gut vorstellen, nach dem Studium in einer Nutztierpraxis zu arbeiten», sagt sie. Auf dem dritten Hof des Tages impft sie unter Redigers Aufsicht mehr als zehn Rinder gegen die Blauzungenkrankheit: Die Tiere werden bald auf eine Alp im Berner Oberland gebracht, wo das von Mücken übertragene Virus bereits mehrfach aufgetreten ist.
Zur Fakultät
Vetsuisse
Die Vetsuisse-Fakultät sichert mit einer forschungsbasierten und praxisorientierten Grundausbildung den Nachwuchs an Tierärztinnen und Tierärzten in der Schweiz. Dank vielfältiger Weiterbildungs- und Spezialisierungsprogrammen ermöglicht die Fakultät das lebenslange Lernen und den Erwerb von national und international anerkannten Qualifikationen. Die Fakultät mit ihren Standorten Bern und Zürich gehört dank exzellenter Lehre und Forschung zu den zehn besten tiermedizinischen Fakultäten der Welt.
Nur bei komplexeren Fällen übernehmen Studer oder Rediger den Lead. Studer etwa diagnostiziert eine Lungenentzündung bei einem Jungrind mit Fieber und schlechtem Allgemeinzustand und verabreicht ihm einen Entzündungshemmer, ein schleimlösendes Mittel und ein Antibiotikum direkt in die Halsvene. Rediger untersucht eine Kuh, die vor zwei Wochen gekalbt hat und seither schwach wirkt. Sie befragt den Bauern, dann misst sie die Körpertemperatur der Kuh, tastet den Bauch ab, klopft, hört, fühlt, testet das Euter, entnimmt Blut. Während sie arbeitet, erklärt sie Schritt für Schritt ihr Vorgehen.
Zur Person

Evi Studer
ist Fachtierärztin für Wiederkäuer und Europäische Spezialistin für Rindergesundheit, sie leitet die Nutztierpraxis Bern, die 2023 an der Wiederkäuerklinik der Vetsuisse-Fakultät der Universität Bern ins Leben gerufen wurde.
Das Resultat eines Schnelltests zeigt schliesslich: zu viele Ketonkörper im Blut. «Ein Kalb zur Welt bringen und dann gleich grosse Mengen Milch geben – das ist eine enorme Belastung für den Stoffwechsel», erklärt Rediger. Christen verabreicht der Kuh eine intravenöse Infusion mit Zuckerlösung. Der Landwirt wird ihr in den nächsten Tagen zusätzlich noch einen Vorläufer von Traubenzucker ins Futter geben, um den Stoffwechsel zu unterstützen. «Das wird sie hoffentlich schnell wieder zu Kräften bringen», sagt der Landwirt.
Nichts für empfindliche Mägen
Um 11.30 Uhr heisst es einmal mehr für alle: Gummistiefel mit dem Schlauch abspritzen, die inzwischen ziemlich verdreckte Schürze ausziehen, falten und im Auto verstauen, auf zum nächsten Einsatz. «Lea, wird dir schlecht, wenn du beim Autofahren schreiben musst?», fragt Rediger. Das ist nicht der Fall, und während sich die Tierärztin ans Steuer setzt, macht sich die Studentin daran, alles genau zu notieren: welchen Impfstoff sie den Rindern gespritzt hat, welche Behandlung die kranke Kuh erhalten hat, welche Medikamente nötig waren.

Um 11.50 Uhr trifft die mobile Praxis auf dem vierten und letzten Hof der heutigen Tour ein: einem Mutterkuhbetrieb in Geristein. Der Betriebsleiter hat sich vor ein paar Tagen gemeldet, weil ein Horn seines Stiers in Richtung Schädel wächst. Nach einem kurzen Gespräch entscheiden Rediger und der Besitzer, nicht das ganze Horn zu entfernen, sondern nur die nicht durchblutete Spitze zu kürzen. Er bindet den Kopf des massigen Stiers am Fressgitter fest, kniet sich vor ihn hin und hält sein Ohr zur Seite. Rediger umwickelt die Hornspitze mit Sägedraht und hält diesen dann mit einer Pinzette an Ort und Stelle, als Christen beginnt, abwechselnd an beiden Enden des Drahts zu ziehen. Der Stier hält still, während der Bauer ihm gut zuspricht. «Etwas langsamere und längere Bewegungen», instruiert Studer, und dann «genau so, super machst du das, Lea. Nicht aufhören.» Nach knapp 30 Sekunden fällt das Hornstück zu Boden.
Zur Person

Isabelle Rediger
ist Fachtierärztin für Wiederkäuer und neben ihrem Engagement für die Nutztierpraxis Bern vertritt sie die Wiederkäuerklinik im Educational Development Team der Vetsuisse-Fakultät.
Um 12.10 Uhr geht es zurück zum Tierspital. Der Arbeitstag ist aber noch nicht zu Ende. Christen wird für anstehende Prüfungen lernen. Rediger hat noch ein Meeting mit Kolleginnen und Kollegen der Fakultät. Zudem muss sie ihre Notizen in die Datenbank eingeben, damit die Informationen zu jeder Kuh beim nächsten Einsatz bereitstehen. Und vielleicht muss sie am Abend noch einmal los: Wenn auf den Feldern Feierabend ist, beginnt im Stall die nächste Schicht. Und die Tierärztinnen stehen bereit, wenn das Notfalltelefon klingelt.
uniAKTUELL-Newsletter abonnieren
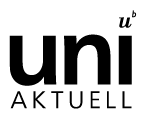
Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.


