Sozialanthropologie
Raserei, Tanzwut, Fallsucht: Massen im Rausch
Wer in einen Rausch gerät, riskiert, das Gleichgewicht zu verlieren – auch das seelische. Es ist ein beängstigender, gleichzeitig lustvoller Zustand, den der Mensch zu allen Zeiten immer wieder bewusst gesucht hat.

Berauscht und ausser sich zu sein, zu schwindeln und zu taumeln sind physische und psychische Verfassungen, die weltweit bei Festen und in rituellen Zusammenhängen zur Schau getragen werden. Auch Trancezustände und ekstatische Tänze gehören zu jenen rauschhaften Entgrenzungen eines «Von-Sinnen-Seins».
Das Wort Rausch ist lautmalerischer Herkunft und bezeichnet sausende und schwirrende Geräusche. Das mittelhochdeutsche Nomen rūsch «Rauschen, Ungestüm» und das entsprechende Verb rūsen «lärmen, schreien, toben, rasen» charakterisieren ungestüme Menschen. Erst im 16. Jahrhundert wurde der Rausch mit Trunkenheit oder einer Benebelung der Sinne als Folge vom Genuss betäubender Mittel in Verbindung gebracht. Die Erweiterung zu seelischer Trunkenheit, Taumel und Ekstase folgte im 18. Jahrhundert.
Als Medienanthropologin interessieren mich insbesondere kollektive Rasereien: ekstatische Zustände, die nicht individuell und primär durch Rauschmittel hervorgerufen wurden, sondern Massenphänomene, die sich nicht allein physiologisch erklären lassen.
«Anno 1374 Mitte des Sommers erhub sich ein wunderlich Ding auf Erden und sunderlich in Teutschen Landen, auf dem Rhein und auf der Mosel, also dass Leut anhuben zu danzen und zu rasen ...» ist in der Chronik von Limbach über einen mysteriösen Ausbruch in Aachen zu lesen. Männer, Frauen und Kinder tanzten so lange auf öffentlichen Plätzen im Kreis herum, bis sie in Ekstase gerieten und ohnmächtig mit Schaum vor dem Mund oder gar tot zu Boden sanken. Aus dem Mittelalter sind über 80 solche Ereignisse in ganz Europa verbürgt.
Veitstanz und Antoniusfeuer
Es handelt sich dabei um ein Massenphänomen, das unter den Namen Veitstanz oder Antoniusfeuer bekannt ist. Eine von vielen Erklärungen geht davon aus, dass es sich bei den dabei auftretenden krampfartigen Muskelzuckungen um Vergiftungserscheinungen handelte, die durch den Mutterkornpilz, einen Getreideparasiten, hervorgerufen werden. Eine andere Bezeichnung ist Tanzwut oder Choreomanie, ein Begriff, der sich aus choreía, zu Deutsch «Tanz», und dem bereits in der Antike bekannten Konzept der mania zusammensetzt, einer Form des göttlich inspirierten Wahnsinns oder der Raserei.
Von den Kirchen wurden Choreomanien häufig als Zeichen von «Besessenheit» oder als religiöse Hysterie gedeutet. Der Heilige Veit und der Heilige Antonius wurden zu Namensgebern für diese Zustände. So wurde Veit bei «Fallsucht», Epilepsie, Krämpfen und Tollwut angerufen. Antonius, der Eremit, wiederum soll in der Wüste von quälenden Visionen und Halluzinationen heimgesucht worden sein. Heiligenbilder und andere Darstellungen dieser «Versuchung durch den Teufel» sollten die Qualen veranschaulichen und unter Halluzinationen Leidende heilen oder zumindest trösten.
«Ältester Flashmob der Welt»
Die wohl bekannteste Choreomanie trug sich im Elsass zu und ging als «Straßburger Tanzwut von 1518» in die Geschichte ein. Im englischen Guardian als «world’s longest rave» oder im Internet als «ältester Flashmob der Welt» bezeichnet, soll sie von nur einer Frau ausgelöst worden sein. «Dieses Tanzes Urheberin war ein Weib namens Troffer, eine halsstarrige, wetterwendische, tolle Kreatur, die alle Menschen, und ihren lieben Mann besonders, durch ihre Albernheiten recht zu ärgern gedachte» ist im Historisch-literarischen Anekdoten- und Exempelbuch zu lesen. In den folgenden Wochen wurden bis zu 400 Menschen von der Tanzwut erfasst. Das Phänomen wurde als eine Form ekstatischer religiöser Verzückung verstanden, die in eine «Massenhysterie» umschlug.
Einer der Ersten, die den Veitstanz von Dämonie und Besessenheitsglauben trennten und als eine Form der Pathologie deuteten, war der Schweizer Arzt und Naturphilosoph Paracelsus. Die Obrigkeit in Strassburg ordnete entsprechend an, die Betroffenen bis zur kompletten Erschöpfung weitertanzen und die Krankheit quasi ausschwitzen zu lassen. Schliesslich wurden sie in die Veitskapelle im elsässischen Saverne gebracht, wo viele wieder zu Sinnen gekommen sein sollen. Springprozessionen wie die im luxemburgischen Echternach, bei der die Teilnehmenden zu Polkamelodien in Reihen durch die Strassen «springen», erinnern an solche kollektiven Choreomanien. Heute stehen sie auf der UNESCO-Liste für immaterielle Kulturgüter.
uniAKTUELL-Newsletter abonnieren
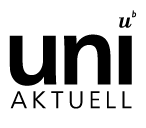
Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.
Wie von der Tarantel gestochen
Im italienischen Apulien ist seit der Antike bekannt, dass der Biss der Wolfsspinne die Betroffenen wild herumspringen lässt, «wie von der Tarantel gestochen». Weil auch dort die Menschen vermuteten, dass wildes Tanzen das Gift schneller aus dem Körper treiben würde, hat sich daraus die Tarantella, ein Volkstanz im 3/8- oder 6/8-Takt entwickelt. In meiner Forschung zur Rezeption und Wiederbelebung von Tarantismus-Bildern stiess ich auch auf Berichte von Frauen aus den 1950er-Jahren, die ihre Choreomanien beschrieben:
«Meine gute Signorina,
zur Zeit des ersten Weltkriegs bin ich auf den Feldern arbeiten gegangen, und während ich arbeitete, habe ich einen starken Biss am Bein verspürt. Nachher konnte ich nicht mehr arbeiten, so schlecht fühlte ich mich, ich ging nach Hause und für lange Zeit tanzte ich», schreibt Michela Margiotta 1965 an die römische Anthropologin Annabella Rossi. Als junge Frau war sie von einem Skorpion gebissen worden und litt als tarantata, als «Tarantelbessene», ein Leben lang unter Fieberattacken, Tobsuchtsanfällen und Epilepsie.
«Ritualisierte Grenzüberschreitungen prangerten kollektive Missstände wie Zwangsheiraten und Unterdrückung weiblicher Sexualität öffentlich an.»
Michaela Schäuble
Jedes Jahr Ende Juni pilgerten bis in die 1980er-Jahre zahlreiche Frauen wie Michela nach Galatina in die Kapelle von San Paolo, dem Schutzheiligen von Gifttieren wie Spinnen und Skorpionen, um ihn um Gnade und Heilung anzuflehen. Vor und in der Kapelle kam es immer wieder zu ekstatischem und grenzüberschreitendem Verhalten: Frauen kletterten auf den Altar, verfielen in Trancezustände, beschimpften den Heiligen lautstark oder urinierten in die Kapelle. Anthropologinnen und Religionshistoriker sehen im Tarantismus Relikte antiker dionysischer Kulte, die vom Katholizismus überformt worden sind und die Zeit überdauern. Sehr häufig wurden in diesen ritualisierten Grenzüberschreitungen auch kollektive Missstände wie patriarchale Strukturen, Zwangsheiraten, Unterdrückung weiblicher Sexualität und Gewalterfahrung öffentlich angeprangert.

Auch heute noch pilgern Gläubige Ende Juni nach Galatina und erbitten Heilung, vor allem für psychische Erkrankungen. Unabhängig davon organisiert in Galatina ein «Club per l’UNESCO» jährlich Reenactments, in denen Filmaufnahmen aus den 1950er- und 1960er-Jahren von den frenetischen Tänzen in der Kapelle von San Paolo nachgestellt werden. Während manche die öffentlichen Aufführungen meist weiblichen Leidens als Touristenattraktion oder Folklore kritisieren, sprechen andere von einer Wiederaneignung und Umbewertung der eigenen Geschichte. Was einst als Raserei, Fallsucht oder unkontrollierter Rausch stigmatisiert wurde, ist heute Bestandteil apulischen Kulturerbes und eine produktive Form des Umgangs mit psychosozialen Spannungen geworden.
In Apulien werden Pestizide und Klimawandel dafür verantwortlich gemacht, dass es keine Giftspinnen und daher keinen «authentischen» Tarantismus mehr gibt. Andere Narrative besagen, dass heutige Umweltgifte oder aber Drogen und Psychopharmaka das Gift der Spinne ersetzen und eine ebenso toxische wie berauschende Wirkung hätten.
Allzu rauschhafte Tänze und kollektives Ausser-sich-Sein werden seit je als Symptome von «Wahnsinn» gedeutet und mit pathologisierenden Begriffen wie Verrücktheit, Manie oder Hysterie bezeichnet. Sehr oft wurde und wird dabei das als krank angesehen, was als fremd und damit bedrohlich gilt. Wenn sich nicht normatives Verhalten also eine Bühne und damit Gehör verschafft, kann dies ein ebenso quälendes wie lustvolles Ausbrechen aus gesellschaftlichen Normen bedeuten – und als Ermächtigung oder Krisenbewältigung erfahren werden. In süditalienischen Tarantismus-Aufführungen werden heute jedenfalls noch immer neben individuellen Leiden und Gewalterfahrungen auch gesellschaftspolitische und ökologische Notstände öffentlich thematisiert.
Zur Person

Michaela Schäuble
ist Professorin für Sozialanthropologie mit Schwerpunkt Medienanthropologie an der Universität Bern und Mitbegründerin von Ethnographic Mediaspace Bern. Sie forscht zu Trancezuständen und ekstatischen Heiligenkulten. Ihr essayistischer Dokumentarfilm «Tarantism Revisited» (zusammen mit Anja Dreschke) ist derzeit in Postproduktion.
Magazin uniFOKUS
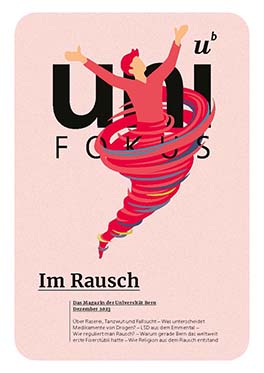
Jetzt kostenlos abonnieren
Dieser Artikel erschien erstmals in uniFOKUS, dem Printmagazin der Universität Bern. uniFOKUS beleuchtet viermal pro Jahr einen thematischen Schwerpunkt aus unterschiedlichen Blickwinkeln.