Dem indigenen Wissen treu bleiben
Welche Rolle sollen die armen Gesellschaften bei der Erreichung der Biodiversitätsziele spielen, fragt Boniface Kiteme mit Blick auf die kommende UNO-Biodiversitätskonferenz. Er leitet das kenianische Ausbildungs- und Forschungszentrum CETRAD, das mit der Universität Bern zusammenarbeitet.
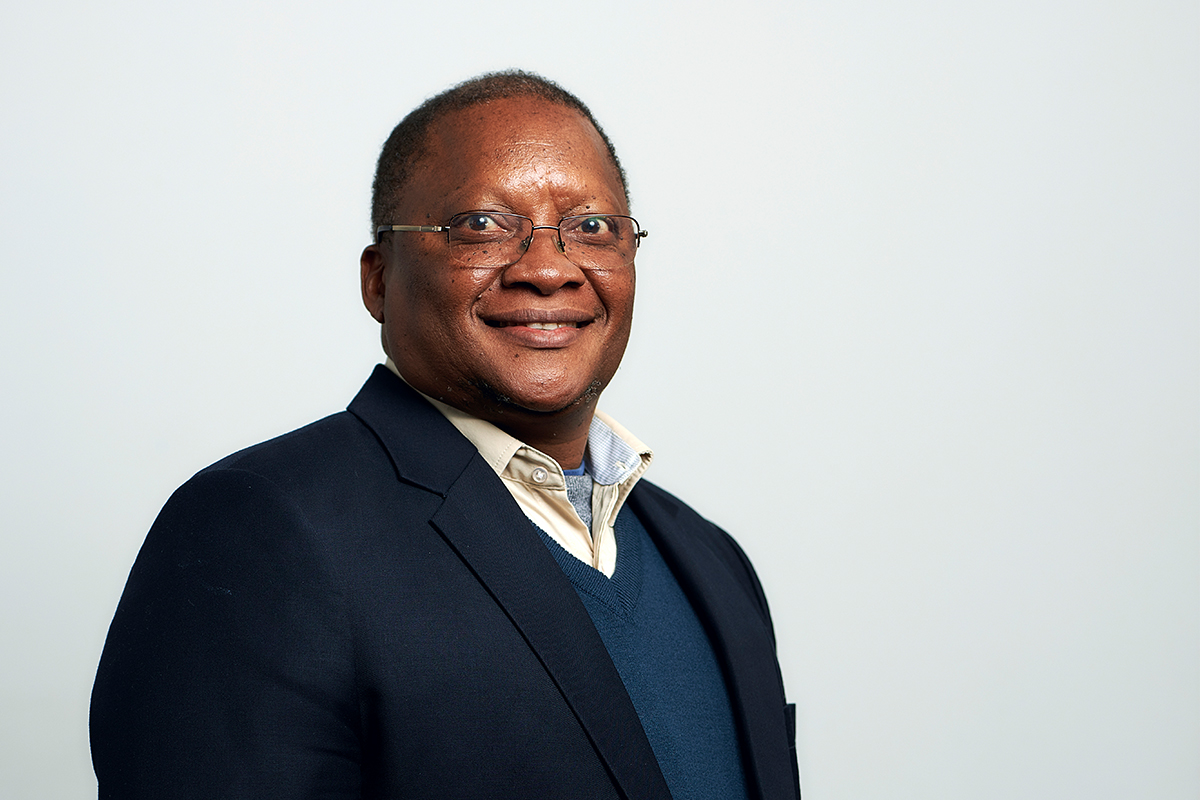
Das Centre for Development and Environment (CDE) und die Wyss Academy for Nature der Universität Bern beleuchten in Interviews mit ihren Expertinnen und Experten einige der wichtigsten Aspekte der anstehenden Verhandlungen im Rahmen der UNO-Biodiversitätskonferenz. «uniaktuell», das Online-Magazin der Universität Bern, übernimmt Interviews aus dieser Serie in gekürzter Fassung.
Die menschlichen Aktivitäten haben deutlich zugenommen: Es sind viele Menschen aus stark besiedelten Gebieten zugewandert, zudem hat sich die Landwirtschaft in Gebiete ausgedehnt, die zuvor eine intakte Biodiversität aufwiesen und in denen sich auch Weideflächen und Wasserstellen befanden. Es entstand Druck auf jeden verfügbaren Raum – einschliesslich auf die Routen, auf denen das Vieh aus dem Norden des Landes in den Süden getrieben wurde, sowie auf die Wanderrouten und Verbreitungsgebiete von Wildtieren. Dieser Druck hat die Vernetzung der Ökosysteme stark beeinträchtigt und zu ernsthaften Konflikten zwischen Mensch und Wildtieren geführt.

Es geht auch um die Elefanten, ja. Sie wissen, wo sie schon vor hundert Jahren durchgezogen sind und benutzen diese Routen weiterhin. Aber jetzt stehen dort Mais-, Kartoffel- oder Bohnenfelder, und die Elefanten fressen die Ernte auf. Die verschärften Konflikte mit den Wildtieren wirken sich negativ auf die Lebensgrundlagen der Menschen aus, insbesondere auf die Ernährungssicherheit der Familien. Aber auch die ehemaligen Viehrouten der Pastoralisten wurden durch neue Ackerbau- und Siedlungsgebiete stark eingeschränkt. (Anm. d. Red: Pastoralisten sind Viehhirten, die eine extensive Naturweidewirtschaft betreiben.)

Wir haben mit dem CDE und anderen Forschungsorganisationen gerade eine sechsjährige Forschung zu Ernährungssystemen abgeschlossen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sind wirklich beunruhigend. Ein enormes Problem sind die Pestizideinsätze: Von 53 Pestiziden, die wir in den landwirtschaftlichen Betrieben identifizierten, sind in der Schweiz nur 17 zugelassen; 36 Produkte enthielten hochgefährliche Wirkstoffe. Dazu kommt die Menge der ausgebrachten Mittel: Kulturen wie Brokkoli und Bohnen wurden bis zu 15 Mal pro Anbauzyklus besprüht. Das hat natürlich starke Auswirkungen auf die Biodiversität – beispielsweise die Bienen – aber auch auf die menschliche Gesundheit.

Die wirtschaftlichen Überlegungen überwiegen bei weitem alle anderen Erwägungen. Das ist das Hauptproblem. Man will die Produktivität steigern und setzt mit dem Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden auf schnelle «Lösungen». Doch es ist an der Zeit, dass wir stattdessen den agrarökologischen Ansatz ernsthaft fördern – zusammen mit anderen Praktiken, die dazu beitragen, degradierte Gebiete wiederherzustellen. Das würde auch der biologischen Vielfalt zugute kommen.
Im Hinblick auf die UN-Biodiversitätskonferenz 2022 gibt es Bestrebungen, bis 2030 30 Prozent der Land- und Meeresflächen der Erde zu schützen. Ist «30x30» ein vielversprechender Ansatz für die Region am Mount Kenya?Wenn wir dieses Ziel verwirklichen wollen, müssen wir uns erstens fragen: Wie sind wir in die aktuelle Situation geschlittert? Diese Frage sollte unabhängig von allen politischen und wirtschaftlichen Überlegungen beantwortet werden. Denn: Die Weltbevölkerung nimmt weiterhin stark zu, die Nachfrage nach Land und Ressourcen steigt täglich. Aber der verfügbare Raum bleibt gleich gross. Darum ist die nächste Frage: Wohin schicken wir die betroffenen Menschen, wenn wir 30 Prozent des Landes unter Naturschutz stellen? Wenn es darauf eine Antwort gibt, kann man sich in Richtung «30x30» bewegen. Wenn nicht, dann denke ich, dass wir die Sache nochmal überdenken sollten – sorry.
Immerhin könnten die jeweiligen Regierungen nach Lösungen suchen.In Kenia hatten wir schon Präsidentschaftskandidaten, die nicht gewählt wurden, weil sie ähnlich gelagerte Strategien befürworteten. Eine Regierung könnte destabilisiert werden, wenn sie die Menschen auffordert, die Schutzgebiete zu verlassen. Das wirft die grundlegende Frage auf: Welche Alternative bieten wir ihnen? Natürlich kann man Gespräche führen. Aber solange die Bevölkerung wächst, wird Land immer knapper. Das bringt mich zur nächsten Frage.
Nämlich?Letzten Sommer diskutierten wir mit den Massai im Laikipia-Plateau über die Korridore. Wir stellten fest, dass sie ein grosses Wissen über den Erhalt von biologischer Vielfalt und den Umgang mit ihrem Lebensraum haben – insbesondere punkto Wanderungsbewegungen von Wild- und Nutztieren. Ihre Tradition etwa, dass ein Mann einer bestimmten Altersgruppe einen Löwen töten muss, bevor er in eine neue Altersklasse aufgenommen wird, mag für Aussenstehende unverständlich sein. Aber es steckt eine Menge Logik dahinter. Denn es ist ein ganz bestimmter Löwe, der getötet werden muss – und welcher das ist, bestimmen die Ältesten. Ein anderer Löwe darf nicht angefasst werden. Warum? Weil die Massai so den Fortbestand der Löwengemeinschaft erhalten wollen. Daher meine Frage: Wie viel indigenes Wissen können, wollen oder müssen wir einbeziehen, um die Ziele des Artenschutzes zu erreichen? Ich bin mir sicher, dass wir diesem Wissen treu bleiben müssen.
Was erwarten Sie persönlich von der Biodiversitäts-Konferenz?Wir müssen uns ganz generell fragen, was der Zweck dieser globalen Konferenzen ist. Sind die Wirkungen, die sie erzielen, den Aufwand wert? Ich bin mir da nicht so sicher. Rund um die «30x30»-Debatte gibt es noch andere Dinge, die diskutiert werden und die ich für grundlegend halte: Welche Rolle sollen die armen Gesellschaften bei der Erreichung der Ziele spielen? Wie gehen wir mit den augenfälligen Unterschieden zwischen den beiden Welten in Nord und Süd um? Und wie viel Zeit verlieren wir bei der Erreichung der Ziele, wenn wir diese Kluft nicht rasch beseitigen?
Was müssen die reichen Länder also tun, damit Entwicklungsländer ihre Biodiversität erhalten können?Die reichen Länder müssen sich fragen, was sie zum Verlust der biologischen Vielfalt beigetragen haben. Das muss nicht verhandelt werden, das können sie selbst überprüfen und sagen: Wir stoppen das. Um nur ein Beispiel zu nennen: Wenn Unternehmen in der Schweiz Pestizide herstellen, die in der Schweiz verboten sind, und diese in Kenia auf den Markt bringen, dann muss die Lösung aus der Schweiz kommen. Zudem haben die reichen Länder technisches Know-how, sie haben mehr finanzielle Mittel zur Verfügung – all das gilt es zu nutzen.
Allerdings möchte ich damit nicht sagen, dass die armen Länder nicht auch selbst handeln können. Auch sie müssen sich fragen, was sie zur heutigen Situation beigetragen haben und was sie tun können. Es braucht nicht für alles finanzielle Mittel, um Fehlentwicklungen rückgängig zu machen.
Dies ist eine gekürzte Version des Interviews, das zeitgleich in ganzer Länge in den CDE-Reihen erschienen ist. Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt, auch Biodiversitätskonvention, ist das wichtigste internationale Abkommen zum Schutz der Biodiversität. 2010 wurden an der 10. Konferenz der Vertragsstaaten die Aichi-Ziele verabschiedet, die bis 2020 hätten erreicht werden sollen – aber klar verfehlt wurden. An der 15. Vertragsstaatenkonferenz (COP15) sollte die Nachfolgevereinbarung der Aichi-Ziele verabschiedet werden. Ursprünglich war die COP15 für Oktober 2020 in Kunming, China, geplant. Wegen der Covid-19-Pandemie wurde sie auf Oktober 2021 verschoben. Ein erster Teil der Verhandlungen fand dann als Videokonferenz statt und führte zu einer wenig konkreten Erklärung, bei welcher der Schutz von 30 Prozent der Erdfläche eine zentrale Rolle spielt. Im März 2022 sollen die Verhandlungen in Genf fortgesetzt werden. Danach soll das Nachfolgeabkommen der Aichi-Ziele im April/Mai 2022 bei einem Präsenztreffen in China verabschiedet werden. Die Präsentationen der Online-Tagungen «Swiss Forum on Conservation Biology» SWIFCOB21 und SWIFCOB22 des Forums Biodiversität Schweiz der SCNAT ergänzen diese Interviewserie und geben einen guten Überblick über die Themenfelder der Verhandlungen. Gaby Allheilig ist Kommunikationsverantwortliche beim Centre for Development and Environment (CDE) der Universität Bern.Dieses Interview in ganzer Länge
UNO-Biodiversitätskonferenz
Tagungspräsentationen zur Ergänzung dieser Interviewserie
CDE Policy brief on pesticides
Über die Autorin