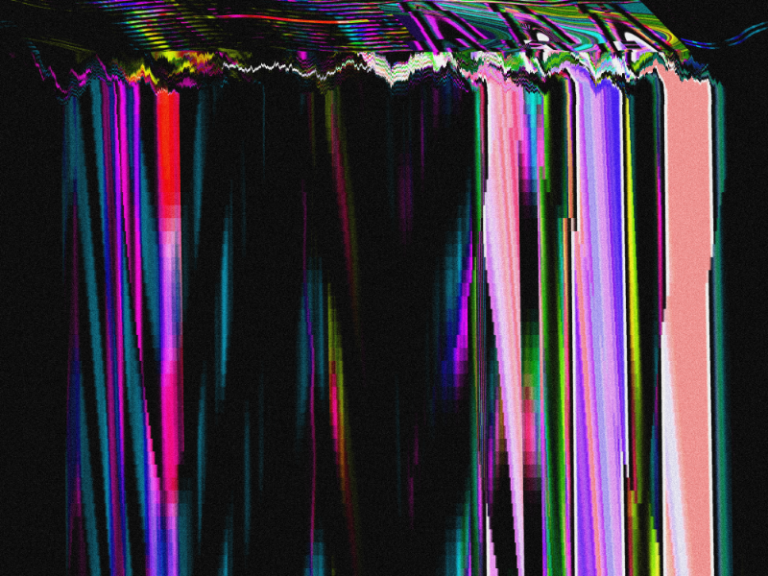Satire unter Druck
Zwischen Meinungsfreiheit und Zensur
Der Genfer Karikaturist Patrick Chappatte und der Berner Medienrechtler Franz Zeller diskutieren über die Grenzen der Meinungsfreiheit und die Rolle der politischen Satire in einer Zeit, in der die traditionellen Medien immer mehr unter Druck geraten.

Herr Chappatte, Anfang Jahr hat die amerikanische Karikaturistin Ann Telnaes bei der «Washington Post» gekündigt, weil die Zeitung eine kritische Zeichnung von ihr nicht veröffentlicht hat. Ist es Ihnen auch schon passiert, dass ein Verlag eine Karikatur von Ihnen nicht veröffentlicht hat, weil er sie für zu riskant hielt?
Patrick Chappatte: Ann Telnaes beschrieb ja eigentlich nur die Realität, als sie die Tech-Mogule zeichnete, die sich vor «König Trump» verbeugen und ihm Geld anbieten. Darunter war auch Jeff Bezos, Eigentümer der «Washington Post». Die Zeitung hatte Angst, die Zeichnung zu veröffentlichen. Telnaes hatte 17 Jahre lang für die «Washington Post» gearbeitet, und ihre Kündigung war eine Reaktion auf diese Selbstzensur. Mit diesem Schritt machte sie klar, dass die Zeitung ihre Verpflichtung gegenüber dem Publikum, der öffentlichen Debatte und gegenüber der Demokratie vernachlässigt. Telnaes hat Mut gezeigt, während die Zeitung ihre eigene Tradition verraten hat. Aber, um auf Ihre Frage zurückzukommen: Mir selbst ist das so nie passiert. Das hat auch mit meiner Arbeitsweise zu tun.
Wie arbeiten Sie?
Chappatte: Ich mache immer mehrere Entwürfe, die ich an die Redaktion schicke, damit sie rückmelden kann, was ihr am besten gefällt. Am Ende entscheide ich, aber durch dieses Vorgehen entsteht eine Diskussion mit dem Team auf der Redaktion. Natürlich sind wir nicht immer einer Meinung. Aber es ist noch nie zum Bruch mit einem Arbeitgeber gekommen.
Magazin uniFOKUS

«Komisch, oder?»
Dieser Artikel erschien erstmals in uniFOKUS, dem Printmagazin der Universität Bern. uniFOKUS beleuchtet viermal pro Jahr einen thematischen Schwerpunkt aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Aktuelles Fokusthema: Humor.
Sind Sie im Laufe der Jahre vorsichtiger geworden?
Chappatte: Ich versuche, nicht vorsichtiger zu werden. Die Arbeit eines Karikaturisten ist ein ständiger Kampf um die eigene Freiheit. Auch die Toleranz des Publikums hat sich verändert.
Sind wir sensibler geworden?
Franz Zeller: Grosse Teile der Gesellschaft sind für bestimmte Themen sensibler geworden, etwa für Geschlechterstereotypen oder für die Situation von behinderten Menschen. Und die rechtliche Situation passt sich diesem Stimmungswechsel an. Das Diskriminierungsverbot in Art. 261bis des Strafgesetzbuchs wurde vor wenigen Jahren um den Aufruf zu Hass wegen der sexuellen Orientierung ergänzt. Gegenwärtig wird im Parlament eine zusätzliche Erweiterung diskutiert: Auch Aufrufe zu Hass aufgrund des Geschlechts sollen künftig strafbar werden.
Chappatte: In den vergangenen Jahren spürten wir Karikaturistinnen und Karikaturisten Druck aus einigen Teilen der Gesellschaft, «Cancel Culture» hat an Bedeutung gewonnen. Heute nutzen Aktivistinnen und Aktivisten die sozialen Medien als Druckmittel, um bei angeblicher oder tatsächlicher Diskriminierung gegen die Redaktionen vorzugehen – und diese werden meist überrumpelt. Jede Abokündigung ist problematisch. Der Gaza-Konflikt war in den letzten zwei Jahren besonders häufig Anlass für solche Interventionen, vor allem bei den deutschsprachigen Medien. Immerhin hat die Rechtsprechung die freie Meinungsäusserung geschützt.
«Grosse Teile der Gesellschaft sind für bestimmte Themen sensibler geworden, und die rechtliche Situation passt sich diesem Stimmungswechsel an.»
Franz Zeller
Kommen die neuen rechtlichen Möglichkeiten tatsächlich gegen Medien zum Einsatz?
Zeller: In der Schweiz sind rechtliche Aspekte eher selten der Grund dafür, dass auf die Veröffentlichung einer Karikatur verzichtet wird. Neuerdings kommen jedoch vermehrt strategische Klagen auf, sogenannte Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs), die darauf abzielen, Medien durch sehr hohe Geldforderungen einzuschüchtern.
Chappatte: Das ist eines der Druckmittel, das autokratische Regimes und aktuell auch die Trump-Administration gegen die Medien einsetzen. Diese müssen sich vor Gericht dagegen wehren. Die «New York Times» sah sich kürzlich mit einer 15-Milliarden-Klage konfrontiert. Natürlich hat das eine abschreckende Wirkung und führt zu Selbstzensur.
Werden diese strategischen Klagen auch in der Schweiz eingesetzt?
Zeller: In der Schweiz richten sich SLAPPs bislang weniger gegen Medien als gegen Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die grosse Unternehmen kritisieren. Zudem sind die Gerichte meiner Meinung nach liberaler geworden. Die Fälle, in denen jemand gegen Karikaturen geklagt hat, sind in der Schweiz sehr selten. Und es braucht viel, damit die Justiz letztlich entscheidet, eine Karikatur sei zu weit gegangen.
Zur Person

Franz Zeller
ist Lehrbeauftragter für öffentlich-rechtliches und internationales Medienrecht an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern sowie für Medien- und Kommunikationsrecht an der Universität Basel. Er unterrichtet zudem Medienrecht an der Schweizer Journalistenschule maz.
Was bringt Sie zum Lachen?
«Ich mag Witze wie diesen: Ein Typ geht zum Psychiater und sagt: ‹Ich bin so deprimiert, was soll ich tun?› Der Psychiater sagt: ‹Gehen Sie in ein Stück von Molière, das heitert Sie auf.› Und der Typ sagt: ‹Ich bin Molière.›»
Und übrige journalistische Inhalte? Sprich: Wie steht es um die Pressefreiheit in der Schweiz?
Zeller: Im internationalen Vergleich steht die Schweiz noch stets sehr gut da: In der Rangliste der Pressefreiheit der Reporter ohne Grenzen (RSF) liegt sie auf Platz neun. Pressefeindliche Tendenzen in weiten Kreisen der Gesellschaft nehmen laut RSF aber zu, ebenso die Medienkonzentration und der wirtschaftliche Druck auf die Branche. Tatsächlich besteht die Gefahr, dass sich auch etablierte Medienhäuser vermehrt vor brisantem und kostspieligem Investigativjournalismus scheuen. Rein rechtlich gab und gibt es verschiedene Defizite, die zu Verurteilungen der Schweiz durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geführt haben. Etwa die unzureichende Abschirmung journalistischer Informationsquellen, unverhältnismässige Schuldsprüche wegen bestimmter Recherchemethoden oder ein manchmal übertriebener Schutz wirtschaftlicher oder menschlicher Reputation.
Wie unterscheidet sich die politische Satire in der Schweiz von anderen Ländern wie Frankreich oder den USA?
Chappatte: 2019 hat die «New York Times», für die ich fast 20 Jahre gearbeitet hatte, die politischen Karikaturen aufgegeben. Grund dafür war eine Karikatur, welche die erste Trump-Administration zeigte, wie sie den israelischen Präsidenten Netanjahu blind unterstützt. Die Zeichnung wurde als antisemitisch abgestempelt, es kam zu Demonstrationen vor dem Redaktionsgebäude. Nach zwei Wochen beschloss der Verlag, in Zukunft auf politische Karikaturen generell zu verzichten, und kündigte auch meinen Vertrag.
Das war eine grosse Veränderung in meiner Karriere: Ich wurde damit konfrontiert, dass ein grosses internationales Medium einen Raum der Freiheit schloss. Insofern ging es mir ähnlich wie Ann Telnaes. In den USA vollzieht sich zurzeit ein tiefgreifender kultureller Wandel, der sich auf beängstigende Weise auf die Meinungsfreiheit und den Humor auswirkt. Wir erleben in den USA die Rückkehr der staatlichen Zensur, die wir schon in Ungarn, China und anderen Ländern beobachten konnten.
In Frankreich hingegen hat politischer Humor eine lange Tradition. Honoré Daumier gilt als Grossvater der politischen Karikatur. Der Kampf für die Pressefreiheit und die Freiheit der Darstellung ging in Frankreich Hand in Hand mit dem Kampf gegen Monarchie und Zensur. Diese Tradition hat auf die Schweiz abgefärbt, vor allem in der Romandie. Deutschland und sein Verhältnis zur Karikatur hingegen sind für mich ein Rätsel. Kommentare, Reden, Analysen, Journalismus gelten als seriös, eine Karikatur gilt hingegen als lustig und daher unseriös. Dabei braucht eine Karikatur nicht lustig zu sein.
«Es ist leicht, mit einem Stift und einem Blatt Papier zu schockieren. Schwieriger ist es, die Leute dazu zu bringen, über deinen Cartoon nachzudenken.»
Patrick Chappatte
Unsere Gesellschaft ist zunehmend polarisiert. Macht diese Entwicklung Ihre Arbeit nicht sogar einfacher?
Chappatte: Es ist simpel, zu provozieren, aber schwierig, die Situation in all ihren Nuancen zu beschreiben. Heute habe ich manchmal das Gefühl, dass ich nuancierter zeichne als die platte Realität.
Zeller: Und Ihre Aufgabe ist es auch, das Publikum zu überraschen, oder? Und man kann nicht überraschen, wenn man nur grob zuschlägt.
Chappatte: Doch, das kann man. Es ist leicht, mit einem Stift und einem Blatt Papier zu schockieren. Schwieriger ist es, die Leute dazu zu bringen, über deinen Cartoon nachzudenken. Um die Ironie zu verstehen, braucht es Bildung und ein Verständnis fürs Doppeldeutige: Ich zeige die eine Sache, deute die andere aber an. Diese Finesse geht heutzutage verloren. Es gibt das Sprichwort «Der Weise zeigt auf den Mond, der Dumme sieht den Finger». Wir schauen nicht mehr so oft zum Mond, wir betrachten nur noch den Finger – und dann gehen wir in die sozialen Medien und treten einen Shitstorm los.
Zur Person
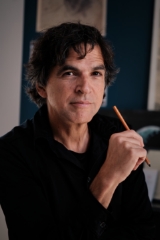
Patrick Chappatte
gehört zu den bekanntesten politischen Karikaturisten weltweit. Der Genfer arbeitet für die «NZZ am Sonntag» und «Le Temps» in der Schweiz sowie für Medien in Deutschland, Frankreich und den USA. Er ist zudem Autor mehrerer Comic-Reportagen. Vor Kurzem veröffentlichte er mit Ann Telnaes das Werk «Censure en Amérique».
Was bringt Sie zum Lachen?
«Ich kann Tränen lachen über dummen Humor, zum Beispiel über Sacha Baron Cohen alias Borat. Ich schäme mich, das zu sagen, weil ich in meiner Arbeit versuche, subtil zu sein.»
Wie hat sich der Anschlag auf «Charlie Hebdo» vor zehn Jahren auf Ihre persönliche Arbeit ausgewirkt?
Chappatte: Das war ein Wendepunkt für die politische Satire, vergleichbar mit 9/11. In Paris wurden Menschen wegen ihrer Karikaturen umgebracht, das gab es zuvor nie. Wir haben vorher über die Unterschiede des Humors in den Ländern gesprochen. Aber heute werden Karikaturen weltweit verbreitet und können dann auf Kreise stossen, die diese Art von Humor nicht verstehen und gewalttätig darauf reagieren. Das muss ich akzeptieren.
Wie gehen Sie persönlich mit Kritik um?
Chappatte: Heute findet Kritik hauptsächlich in den sozialen Medien statt. Ich habe verschiedene solcher Kanäle, über die ich meine Arbeiten poste. Aber ich interagiere nie.
uniAKTUELL-Newsletter abonnieren
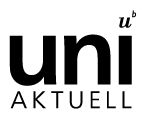
Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.
Sie erklären Ihre Arbeiten nicht?
Chappatte: Mich zu erklären, ist für mich verlorene Zeit. Das geht alles in diesem Social-Media-Müll unter. Also poste ich einfach mein Ding und lasse die Leute debattieren.
Verliert die politische Satire in den Schweizer Zeitungen an Bedeutung?
Zeller: Sie hat es sicher schwer in den herkömmlichen Printmedien – zumindest in der Deutschschweiz. Aber ich bin sicher, sie hat eine Zukunft. Wir brauchen Humor, wir brauchen Kunst. Ich bin da optimistisch.
Chappatte: Politische Satire hat immer einen Weg gefunden, sich zu äussern. Aber ihre Entwicklung ist eng mit der Entwicklung der Medien verbunden, und hier ist der Trend nicht gut. Einige Karikaturistinnen und Karikaturisten suchen Alternativen, sie sind auf bestimmten Plattformen wie Substack sehr erfolgreich. Sie bauen sich ein grosses Publikum auf, verdienen Geld. Es gibt auch andere Formen, etwa das Theater: Ich habe letztes Jahr etwa 40 Vorstellungen meiner Show «Chappatte en scène» gegeben, und sie waren alle ausgebucht.