Alte Knochen, neue Erkenntnisse
Skelettfunde mit Jodmangelsyndrom aus Riggisberg
Bei Skelettfunden aus Riggisberg (BE) haben Forschende der Universität Bern Hinweise auf das angeborene Jodmangelsyndrom entdeckt. Die Studie wirft neues Licht auf die Geschichte und Ausbreitung der Erkrankung in der Schweiz.

Jod ist ein lebenswichtiges Spurenelement. Laut Schätzungen der WHO leiden weltweit immer noch 2 Milliarden Menschen an leichtem Jodmangel. Dass das Jodmangelsyndrom in der heutigen Schweiz praktisch verschwunden ist, liegt an einem entscheidenden Schritt der Sozialmedizin: «Der drastische epidemiologische Rückgang der schweren Jodmangelsymptome fällt zusammen mit der Anreicherung des Kochsalzes mit Jod vor über hundert Jahren. Die Forschung mehrerer Schweizer Ärzte hatte zu dieser Entscheidung geführt», erklärt Sandra Lösch, Leiterin der Abteilung Anthropologie am Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern. Die Schweiz war 1922 weltweit das erste von zahlreichen Ländern, welche politische Massnahmen zur Bekämpfung dieser Erkrankung trafen.
Jodmangel früher und heute
Bei der Untersuchung von historischen Skeletten aus dem Friedhof des ehemaligen Armenhauses in Riggisberg im Kanton Bern fand das Team um Sandra Lösch Hinweise auf das angeborene Jodmangelsyndrom, ein in Vergessenheit geratenes Krankheitsbild. Das Syndrom, historisch auch als «Kretinismus» bezeichnet, war bis Anfang des 20. Jahrhunderts besonders in den alpinen Regionen der Schweiz verbreitet. Es führt zu körperlichen und geistigen Einschränkungen wie Kleinwüchsigkeit, Knochenfehlbildungen und kognitiven Entwicklungsdefiziten.

Untersuchung der Skelettfunde
Das Team der Abteilung Anthropologie am Institut für Rechtsmedizin untersucht alle menschlichen Knochen, die im Kanton Bern gefunden werden. Im Rahmen dieser Studie analysierten sie 121 Skelette von Erwachsenen, die in Riggisberg beigesetzt wurden. Bei vier Individuen konnten sie typische Merkmale der Erkrankung feststellen, darunter Kleinwuchs und eine charakteristische Schädelform. Sechs weitere Skelette waren mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls von der Krankheit betroffen. «Es handelt sich um eine Studie, die systematisch Skelettmarker bei angeborenem Jodmangelsyndrom im archäologischen Kontext untersucht und den beschränkten Datensatz von paläopathologischen Fällen des Jodmangelsyndroms erweitert», erklärt Lösch.

Unentdeckte Fälle und Herausforderungen in der Diagnostik
Die Forschenden verglichen die Funde aus Riggisberg mit einer Referenzgruppe von 2314 dokumentierten Skelettfunden des Kantons Bern. Dabei stellte sich heraus, dass das Jodmangelsyndrom bei archäologischen Bestattungen erwachsener Personen im Vergleich zu epidemiologischen Daten unterrepräsentiert ist. «Unsere Untersuchung deutet darauf hin, dass einige Fälle des angeborenen Jodmangelsyndroms bei archäologischen Funden möglicherweise nie diagnostiziert wurden. Entsprechend fehlen Hinweise auf Betroffene in archäologischen Beständen», sagt Christine Cooper, Erstautorin der Studie. Gründe dafür könnten die hohe Säuglingssterblichkeit von betroffenen Personen sein, sowie die Schwierigkeit, das Syndrom bei Skeletten von Heranwachsenden zu diagnostizieren.
«Die Ergebnisse dieser Studie sind ein bedeutender Schritt, um die Diagnostik von Erkrankungen, die heute weitgehend verschwunden sind, mittels archäologischer Knochenfunde zu verbessern», erklärt Sandra Lösch. «Zukünftige Forschung könnte dazu beitragen, weitere Fälle zu identifizieren und unser Wissen über die Verbreitung dieser Erkrankung in der Vergangenheit zu vertiefen.»
Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen sieht auch heutzutage bei den Massnahmen für eine bessere Jodversorgung der Schweizer Bevölkerung noch Spielraum. Es empfiehlt auf eine ausreichende Versorgung mit Jod zu achten.
Angaben zur Publikation
Cooper C, Keller F, Alterauge A, Lösch S. Endemic congenital iodine deficiency syndrome from a 19th to 20th century poorhouse cemetery in Riggisberg, Switzerland. Int J Paleopathol. 2025 Jul 1;50:44-56. doi: 10.1016/j.ijpp.2025.06.004. Epub ahead of print. PMID: 40601994.
URL: sciencedirect.com/science/article/pii/S1879981725000361
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpp.2025.06.004
Zur Person

Dr. Sandra Lösch
Dr. Sandra Lösch hat Biologie mit Hauptfach Anthropologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) studiert. Seit 2010 ist sie Leiterin der Abteilung Anthropologie am Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern, Schweiz. Sandra Lösch betreut SNF-geförderte Projekte über die Menschen der Ur- und Frühgeschichte und des Mittelalters. Ihr Team bearbeitet menschliche Überreste von archäologischen Ausgrabungen aus verschiedenen Kantonen und aus dem Ausland.uniAKTUELL-Newsletter abonnieren
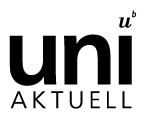
Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.