Swiss Governance Forum 2025
Gesundheitsforschung trifft Alltag
Die Schweiz hat eines der leistungsfähigsten und teuersten Gesundheitssysteme. Das Swiss Governance Forum 2025 fragte, wie es gelingen kann, trotz Regulierung die Innovation nicht abzuwürgen: Neben Eigeninitiative braucht es Kooperation.

Die Pandemie sitzt vielen von uns noch in den Knochen. Und doch ist der Kampf gegen das Coronavirus ein gutes Beispiel dafür, wie die Gesundheitssysteme in der Schweiz und weltweit mit einem neuen Problem relativ gut fertigwerden können. In Rekordzeit wurden Impfstoffe gegen den Erreger entwickelt sowie Präventionsmassnahmen evaluiert und umgesetzt. Ganz nebenbei erlebte die Digitalisierung einen kräftigen Schub.
Regulierung als wichtige Basis
Selbstverständlich war während der Pandemie vieles umstritten, fast jede Massnahme rief Widerstand hervor. Aus der Krise geholfen hat, interdisziplinär zu denken. Und dieses Denken über den eigenen Fachbereich hinaus müsse uns leiten, wenn wir weitere Probleme im Gesundheitssystem lösen wollten, sagte Virginia Richter, Rektorin der Universität Bern, als sie Ende Juni das Swiss Governance Forum 2025 eröffnete.
Die Veranstaltung diskutiert seit 2017 alle zwei Jahre komplexe gesellschaftliche Herausforderungen. In der Gesundheitspolitik gebe es kein Schwarz oder Weiss, kein Richtig oder Falsch, so Richter: «Gerade Bern als Volluniversität ist prädestiniert dafür, eine Fragestellung aus einer Vielzahl von Perspektiven zu analysieren und so Antworten zu finden, die langfristig Gültigkeit haben.»
«Forschung allein bringt wenig, entscheidend ist, ob und wie schnell Patientinnen und Patienten Innovationen im Alltag spüren.»
– Rudolf Blankart
Mit dem Kompetenzzentrum für Public Management (KPM), das neben dem Swiss Institute for Translational and Entrepreneurial Medicine (sitem-insel AG) zur Veranstaltung eingeladen hatte, arbeite an der Universität Bern seit über 20 Jahren eine kompetente Institution zu diesem Thema. sitem-insel wiederum beschäftigt sich vornehmlich mit der Frage, wie neue Forschungserkenntnisse aus der Medizin in die klinische Praxis überführt werden können.
Plattformen für bessere Lösungen
Für Rudolf Blankart, Professor am KPM und Geschäftsleitungsmitglied der sitem-insel AG, gibt es in unserem Gesundheitssystem zu viele Schwachstellen und Zielkonflikte, als dass alle Probleme mit einem einzigen Federstrich eliminiert werden könnten. Da ist etwa die verhaltene Digitalisierung, «und das in einem Land, das für sich beansprucht, das Internet erfunden zu haben». Regulierung sei immer eine Gratwanderung: Sie könne Fehlanreize schaffen, die veraltete Behandlungsformen zementierten und Innovationen verhinderten, biete aber auch die nötigen klaren Leitplanken.

Die Aufgabe der Wissenschaft jedenfalls sei es, Evidenz zu liefern – «auch wenn die Politik immer wieder ohne oder sogar konträr zu den wissenschaftsbasierten Grundlagen entscheidet», kritisierte Blankart. Forschung allein bringe wenig. Entscheidend sei, ob und wie schnell Innovationen in den Alltag der Patientinnen und Patienten Eingang fänden.
uniAKTUELL-Newsletter abonnieren
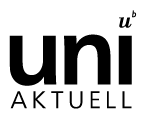
Entdecken Sie Geschichten rund um die Universität Bern und die Menschen dahinter.
Als positives Beispiel nannte er einen runden Tisch, der sich im kontinuierlichen Austausch mit Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Forschung für die Entwicklung neuartiger Antibiotika einsetzt. Es gilt, die Denkweise im Umgang mit Problemen zu verändern: «Wichtiger als die Durchsetzung der eigenen Position muss im Gesundheitswesen sein, das Zusammenspiel zwischen den Akteuren zu verbessern.»
Bevölkerung mit klarem Blick
Tatsächlich seien nicht immer alle politischen Vorstösse wissenschaftsbasiert, beklagte BAG-Direktorin Anne Lévy. Das Abstimmungsverhalten der Bevölkerung in der jüngsten Vergangenheit hingegen stimmt Lévy optimistisch: Die Annahme der Pflegeinitiative und der Initiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» zeige, dass eine Mehrheit des Stimmvolks erkannt habe, wie wichtig eine ausreichende personelle Versorgung respektive die Prävention seien.

Lévys Vorgänger Thomas Zeltner wiederum blickte in der Diskussion fast etwas wehmütig auf die Zeit zurück, als er das neu aufkommende Phänomen HIV managen musste. Damals sei das Primat der Wissenschaft noch nahezu unangefochten gewesen. Heute hingegen werde in Gesundheitsfragen stark politisiert, statt dass man sich auf evidenzbasiertes Wissen berufe, meinte Zeltner.
Innovationen durch Zusatzversicherung?
Trotz strenger Regulatorien ist die Gesundheitsbranche ein Geschäft. Die Hirslanden-Gruppe beispielsweise hat sich auf Zusatzversicherte spezialisiert, doch die Margen seien angesichts sinkender Tarife unter Druck, klagte Niowi Näf, Mitglied der Hirslanden-Konzernleitung. Ein Problem für Privatspitäler sei, dass sich die Zusatzversicherungen derzeit zu vier Fünfteln mit Angeboten aus den Bereichen Komfort, Zugang und Wahlfreiheit profilierten, während nur 20 Prozent der Zusatzleistungen auf klinische und präventive Innovationen entfallen.

Wenn aber schon die Prämien der Grundversicherung viele Versicherte überfordern und immer mehr Spitäler von sich aus auch Allgemeinversicherten ein Einzelzimmer anbieten, erodiert die Attraktivität von Zusatzversicherungen weiter. Hirslanden wolle deshalb stärker auf medizinische Exzellenz setzen, erklärte Näf. Mittelfristig würden diese Innovationen, sofern sie evidenzbasiert seien, auch in die Grundversicherung aufgenommen und damit allen Versicherten zugänglich, ist sie überzeugt.
Wo bleibt das elektronisches Patientendossier?
Viel Raum nahm am Swiss Governance Forum das Thema Digitalisierung ein. An sich ist Digitalisierung ein valables Instrument, um das Personal in Medizin und Pflege zu entlasten und gleichzeitig Kosten zu sparen. Doch entsprechende Vorhaben kommen nur langsam vom Fleck. Das elektronische Patientendossier (EPD) der Post-Tochter Sana Health AG etwa konnte erst 60'000 Versicherte anlocken – weniger als ein Prozent der Schweizer Bevölkerung.
CEO Matthias Glück monierte denn auch die unzähligen Schnittstellen, die es zu bewältigen gebe, und die «doppelte Freiwilligkeit» sowohl der Gesundheitsinstitutionen als auch der Versicherten, sich einem digitalen Tool anzuschliessen.
«Der Bund müsste ein elektronisches Patientendossier zur Verfügung stellen»
– Annamaria Müller, Präsidentin Verwaltungsrat freiburger spital
Annamaria Müller, ihrerseits Mitglied in verschiedenen Verwaltungsräten von Spitälern, spottete hingegen über das bisherige «Gebastel» beim elektronischen Patientendossier. «Statt dass sich die Versicherten umständlich selbst drum kümmern müssen, wäre es besser, der Bund würde von sich aus allen ein Dossier zur Verfügung stellen. Dann kann jede Person entscheiden, ob sie sich anmelden will.» Müller warf aber auch die Frage auf, warum sich denn nicht die Kantone untereinander auf ein gemeinsames System oder zumindest einheitliche Schnittstellen einigen könnten, um die Digitalisierung vorwärtszubringen.

Die Kantone würden durchaus mehr Einheitlichkeit befürworten, ergänzte die Luzerner Gesundheitsdirektorin Michaela Tschuor. Sie appellierte aber an den Bundesrat, diesbezüglich aktiv zu werden, um eine flächendeckende Lösung oder zumindest klare Zertifizierungsvorgaben zu erhalten. Laut Tschuor hat man in der Innerschweiz mit digitalen Lösungen im Gesundheitswesen gute Erfahrungen gemacht.
Universitäten als Innovationstreiber
Vier Stunden reichen nicht, um alle Baustellen in einem komplizierten, jahrzehntelang gewachsenen Konstrukt wie dem schweizerischen Gesundheitssystem zu entschärfen. Aber die Tagung hat die Vielschichtigkeit aufgedröselt, die Player zusammengebracht und Ideen vorgestellt, um Innovation und Digitalisierung in diesem äusserst komplexen Umfeld voranzubringen.

Die Universität Bern war dabei nicht nur Gastgeberin. Sie und die Forschung generell sind auch jene Partner, die medizinische Ideen auf ihre Evidenz prüfen, die nötigen Datengrundlagen erarbeiten und mithelfen, Innovationen vom Labor in den OP-Saal zu überführen.
Zum Kompetenzzentrum für Public Management
Das Kompetenzzentrum für Public Management der Universität Bern wurde 2002 gegründet. Es ist ein schweizweit und international bekanntes Forschungszentrum auf dem Gebiet der Verwaltungswissenschaft. Als interfakultäre Einheit der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen sowie der Rechtswissenschaftlichen Fakultät sieht es sich der inter- und multidisziplinären Forschung zwischen den Disziplinen Ökonomie, Politikwissenschaft und Recht verpflichtet. Kernprodukte des Zentrums sind die Grundlagenforschung im Bereich der Steuerung öffentlicher Institutionen und Aufgaben, der Master-Studiengang Public Management & Policy (PMP) sowie die Nachdiplomstudiengänge Executive Master of Public Administration (Executive MPA) und der CAS-Lehrgang «Management und Politik öffentlicher Institutionen» (CeMaP). Zudem werden Dienstleistungen für die öffentliche Hand in Form von Analysen, Gutachten und Evaluationen erbracht.

