Politikwissenschaft
Im Schneckentempo zum Umweltgesetz
Was tut die Politik, damit es der Umwelt besser geht? Die Politikwissenschaftlerin Karin Ingold untersucht, welche Prozesse und Mechanismen zu einem neuen Gesetz führen. Dabei räumt sie freimütig ein, dass es oft politikfremde Einflüsse sind, die Verhaltensänderungen oder eine strengere Gesetzgebung bewirken.

Rückstände aus Medikamenten, Kosmetika, Pestiziden und Putzmitteln, sie alle werden in herkömmlichen Kläranlagen nur unzureichend zurückgehalten. Das ist ein Problem, denn die organischen Spurenstoffe, sogenannte Mikroverunreinigungen, können Fischen und anderen Lebewesen schaden. Was die Wissenschaft in den Neunzigerjahren erkannte, floss in den politischen Prozess ein: 2016 beschloss der Bundesrat, einen Fonds einzurichten, mit dem bis 2040 die Aufrüstung der 100 grössten Schweizer Abwasserreinigungsanlagen finanziert wird.
Klimawandel ist längst bekanntDie Wissenschaft identifiziert ein Problem, entwickelt zusammen mit der Verwaltung eine Lösung und übergibt sie der Politik, die am Schluss den nötigen Entscheid fällt: «So funktioniert das Zusammenspiel der verschiedenen Player gemäss Lehrbuch», sagt Karin Ingold. Und dieses Zusammenspiel von belebter Umwelt und den Mechanismen der Politik faszinieren die Professorin am Institut für Politikwissenschaft der Universität Bern. Zu Beginn ihrer akademischen Laufbahn konnte sie sich nicht entscheiden, ob sie sich mehr der Natur oder der Politikbeobachtung zuwenden sollte. Mit einem Spagat schafft sie nun beides: Ihr Lehrstuhl für Policy Analysis mit Schwerpunkt Umwelt (Policy Analysis and Environmental Governance [PEGO]) am Institut für Politikwissenschaft ist nicht nur in Bern, sondern auch in der Forschungsabteilung Umweltsozialwissenschaften der EAWAG in Dübendorf verankert, also am Wasserforschungsinstitut der ETH. So ist Ingold nahe an den Natur- und Ingenieurwissenschaften. Gleichzeitig kann sie wissenschaftlich untersuchen, wie die Menschen auf Umweltprobleme reagieren. Dass sie zusätzlich als Vizepräsidentin des Oeschger-Zentrums für Klimaforschung (OCCR) amtet, dokumentiert, wie wichtig ihr Klimafragen sind. Das Klima ist denn auch das Stichwort, auf das hin sie offen ihren Frust äussert: Dass der Klimawandel real sei, wisse man seit 30 Jahren. «Getan hat sich seither extrem wenig, sowohl auf persönlicher Ebene als auch in der Politik.» Ihren Studierenden sage sie deshalb ganz ehrlich, dass man sich bei ihr manchmal an einem «Depro-Thema» abarbeite.
Analysen am PC und Gespräche auf dem AckerDas Beispiel der Mikroverunreinigungen taugt zwar für das Lehrbuch, ist aber nicht repräsentativ für den Gang der Umweltschutzregulierung in den besonders gemächlich mahlenden Mühlen der Schweizer Politik. In der direkten Demokratie gilt: «Streit braucht Zeit.» Ingold nimmts gelassen und sieht auch Vorteile im Schneckentempo, das der Politik manchmal attestiert wird. Denn was hierzulande einmal eingeführt ist, wird dafür so schnell nicht wieder umgestossen. «Die so erzielte breite Akzeptanz hilft dann der Umsetzung. Auch ohne Zwang sieht eine Mehrheit der Bevölkerung die Sinnhaftigkeit etwa von bleifreiem Benzin oder Tempolimits», ist Ingold überzeugt. Mit ihrem Team nimmt sie diese Prozesse unter die Lupe und analysiert sie, meist am Schreibtisch und vor dem Bildschirm. Daneben schätzt sie aber auch den persönlichen Kontakt. Dazu trifft sie sich mit Personen aus der kantonalen oder kommunalen Verwaltung, lässt sich etwa von einem Brunnenmeister in die Trinkwasserproblematik einer Landgemeinde einführen oder hört einer Bäuerin zu, die ihre Nöte schildert, wenn gewisse Pestizide verboten werden.
Auch mit Umweltministerin Simonetta Sommaruga tauscht sie sich regelmässig aus. Denn was in Sachen Klimaschutz nottut, ist an sich längst bekannt. Doch der Weg zum Ziel ist harzig. So könnte helfen, zu untersuchen, wie früher ein Umweltgesetz eine Mehrheit gefunden hat. Dabei hilft Ingolds Erfahrung, dass Wissenschaft nach ganz anderen Regeln und Rhythmen tickt als die Politik – und diese wieder anders funktioniert als die Verwaltung. Es braucht deshalb ein vertieftes Verständnis der verschiedenen Systeme, um eine Zusammenarbeit überhaupt zu ermöglichen. Erst dann kann auf eine erfolgreiche Umweltregulierung hingearbeitet werden.
Politprognosen sind ein hartes MetierKlima, Biodiversität, Energie- und Wasserknappheit: Umweltkrisen und damit Forschungsobjekte gibt es zuhauf. Ingold weiss: Technik allein genügt zur Lösung nicht. Nach dem Muster der Coronapandemie eine neue Taskforce für ein neu erkanntes Problem aufzustellen, könne im Einzelfall helfen. «Immer hängt es jedoch von Menschen ab, die gut miteinander zusammenarbeiten.» In solchen interdisziplinären Teams müssen Umweltverbände, Gesellschaft und Wirtschaft vertreten sein. Am Schluss muss die Politik die Priorisierung übernehmen.

Mit der Politik ist es allerdings so eine Sache. Gerade aktuelle Themen sind zwar attraktiv, um sich zu profilieren. Doch hin und wieder haben sich die politischen Akteure noch keine Meinung darüber gemacht oder ändern sogar ihre Position. Das verkompliziert selbstverständlich auch die Analyse des politischen Prozesses. Am erfolgreichsten sind Ingold und ihr Institut deshalb, wenn es darum geht, rückblickend Vorgänge zu analysieren und zu zeigen, wie es zum Entscheid – in der Schweiz in den allermeisten Fällen einem Kompromiss – gekommen ist. Deutlich anspruchsvoller, aber auch gefragter ist es, Voraussagen zu machen und einen politischen Prozess der Zukunft zu modellieren und Szenarien zu entwickeln.
Klimapolitik braucht SozialwissenschaftenEine Anerkennung für ihre Disziplin hat sie seit Anfang Jahr in Form des Präsidiums von ProClim. Das Forum für Klima und globalen Wandel illustriert, dass die Sozialwissenschaften ein integraler Bestandteil sind, wenn es darum geht, Auswege aus der Klimakrise zu finden. Für Ingold zeigt dieser Schritt, dass sich der stark naturwissenschaftlich geprägte Zirkel öffnet, interdisziplinär arbeitet und damit auch die Bedürfnisse und die Funktionsweise der Gesellschaft berücksichtigt. Nicht nur mit ihrem Forschungsobjekt, auch mit ihren Studierenden will Ingold anders umgehen als in der Vergangenheit üblich: «Im akademischen Milieu wird enorm viel kritisiert, es gehört einfach dazu.» Sie selbst hatte in ihrer Laufbahn immer wieder Menschen um sich, die nicht nur kritisierten, sondern die angehende Professorin auch aufmunterten und sie so stärkten. «Lob ist enorm wichtig. Ich habe mir das zu Herzen genommen und versuche, meine Studenten und Studentinnen etwas häufiger zu loben.»
Politik erklärt nicht allesNaturgesetze und wissenschaftliche Erkenntnisse sind glasklar, doch Politik und Gesellschaft foutieren sich regelmässig darum. In Bezug auf den Klimaschutz ist das frustrierend. Doch es gibt auch erfreuliche Überraschungen, etwa den rasanten Aufstieg der Elektromobilität oder den ebenfalls nicht politikgesteuerten Trend zu Vegetarismus und Veganismus. «Solche Entwicklungen zeigen, dass Politik nur ein Treiber von mehreren ist, wenn es um ökologische Fortschritte geht. Bedeutsam sind beispielsweise gesellschaftliche Trends, wirtschaftliche Entwicklungen oder Katastrophen», relativiert die Forscherin etwas demütig ihr Forschungsobjekt. Bescheidenheit gelehrt hat rückblickend beispielsweise die Art, wie die Schweiz am 25. Mai 2011 der Atomkraft den Rücken kehrte. Nicht Bauplatzbesetzungen, der jahrzehntelange Hickhack an der Urne oder die hartnäckige Opposition gegen Endlager für radioaktiven Abfall gaben den Ausschlag, sondern das Reaktorunglück von Fukushima: Bloss zehn Wochen nach den Verheerungen in Japan überzeugte die damalige Energieministerin Doris Leuthard den Gesamtbundesrat, schrittweise auszusteigen.
Über Karin Ingold
Prof. Dr. Karin Ingold ist Professorin für Policy Analysis and Environmental Governance am Institut
für Politikwissenschaft der Universität Bern.
Kontakt: karin.ingold@unibe.ch
Neues Magazin uniFOKUS
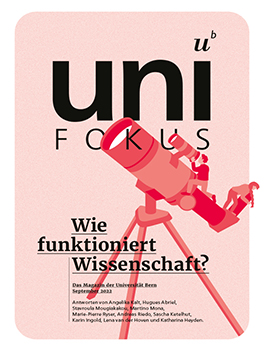
Jetzt gratis abonnieren!
Dieser Artikel erschien erstmals in uniFOKUS, dem neuen Printmagazin der Universität Bern. uniFOKUS zeigt viermal pro Jahr, was Wissenschaft zu leisten vermag. Jede Ausgabe fokussiert aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf einen thematischen Schwerpunkt und will so möglichst viel an Expertise und Forschungsergebnissen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Bern zusammenführen.
Das Online-Magazin der Universität Bern

uniAKTUELL als Newsletter abonnieren
Die Universität Bern betreibt Spitzenforschung zu Themen, die uns als Gesellschaft beschäftigen und unsere Zukunft prägen. Im uniAKTUELL zeigen wir ausgewählte Beispiele und stellen Ihnen die Menschen dahinter vor – packend, multimedial und kostenlos.