Toxische Separatwelten
Mit ihrem neuen Buch «Sexualisierte Gewalt in kirchlichen Kontexten» leisten drei Forschende der Universität Bern einen Beitrag zu Grundlagenforschung und besserer Prävention. Sie zeigen auf, dass kirchlichen Separatwelten bei der Ermöglichung sexualisierter Gewalt eine wichtige Bedeutung zukommt.

Bisher fehlte eine interdisziplinäre Auseinandersetzung mit Grundproblemen in Religionsgemeinschaften und Kirchen hinsichtlich spezifischer Ermöglichungsbedingungen für sexualisierte Gewalt. Hier setzt das heute bei De Gruyter erschienene Buch an. Es nimmt Themen in den Blick, die bislang ungenügend mit sexualisierter Gewalt verbunden wurden – wie Rede- und Denkweisen, die in bestimmten religiösen Bereichen üblich sind. Ziel des Buches ist es, am Beispiel christlicher Kirchen über ambivalente Strukturen aufzuklären und Bedingungen zu identifizieren, die sexualisierter Gewalt Vorschub leisten. Letztlich soll diese Publikation auch einer wirksamen Prävention dienen.
Ein systemisches Problem
Vielfache Enthüllungen von Personen, die in kirchlichen Kontexten Ziele sexualisierter Gewalt geworden sind, machen bisher wenig thematisierte Problembereiche erkennbar. Gemeint sind patriarchale Denk- und Handlungsmuster sowie ausgeprägte Formen von Klerikalismus, also einer sozialen Höherstellung von religiösen Amtsträgerinnen und Amtsträgern. Gemeint ist aber auch das «Tabu der expliziten Formulierung» besonders in körperlichen Angelegenheiten: Körperlichkeit und Sexualität bleiben unausgesprochen. Bis heute sind solche in vielen religiösen Kontexten etablierte Muster noch nicht genügend auf ihre Missbrauchsanfälligkeit hin untersucht worden.
Bei einer vertieften Analyse des Problems sexualisierter Gewalt stehen also nicht einzelne Wirkfaktoren im Zentrum, sondern die die systemischen Grundlagen.

Separatwelten führen zu Ausgrenzung
Zum einen geht es um kirchliche und theologische Strukturen, die Separatwelten hervorbringen und so sexualisierte Gewalt ermöglichen. Separatwelten zeichnen sich dadurch aus, dass sie von Eingeweihten als selbstverständlich angenommen werden, externen Personen aber fremd sind und bei ihnen sogar Ablehnung auslösen können. Partnerschaften und Familien, Institutionen, Unternehmen, Religionen und Kulturen zeigen sich als solche Separatwelten. Positiv gesagt erlauben sie Andersheit und Eigenart, negativ gewendet führen sie zu Ausgrenzung und starren Festlegungen. So gehört die Erzeugung überscharfer religiöser Kontraste, zum Beispiel zwischen Drinnen und Draussen, Amt und Person, Klerus und Laien, Körper und Seele, Wort und Wirklichkeit zu den Grundbedingungen sexualisierter Gewalt in kirchlichen Kontexten. Durch sprachliche und soziale Codes, durch Inszenierungen und Riten, durch ein bestimmtes Denken und daraus abgeleitetes Handeln werden teilweise toxische Separatwelten kreiert, die Personen von sich selbst entfremden.
Im Vergleich mit anderen sozialen Arrangements fällt die Wucht auf, mit der Separatwelten durch kirchliche Praxis entstehen können. Besonders deutlich wird dies, wenn Gegenwelten konzipiert und gelebt werden, die sich von der anderen, «der bösen Welt» so abgrenzen, als sei die umgebende Gesellschaft ein Übel.

Herablassung gegenüber Frauen, Kindern, Jugendlichen, LGBTIQ-Personen
Zur Fundamentalstruktur einer massiven Gefährdung der psychischen und körperlichen Gesundheit von Personen durch sexualisierte Gewalt gehören auch bestimmte religiöse Annahmen in fast allen Traditionen, die Herablassung, ja Verachtung gegenüber Weiblichkeit, Kindlichsein und Jugendlichkeit gebilligt oder sogar gefördert haben. Heute stellen solche Annahmen zunehmend Separatwelten dar. Ein damit verbundener Zwang gegen Frauen oder Minderjährige schafft Rahmenbedingungen für das Ausagieren sexualisierter Gewalt. Aufgrund bestimmter körperlicher Eigenschaften und sozialer Positionen erleben dabei Menschen regelmässig Herabsetzungen, an welche bestimmte Formen sexualisierter Gewalt anknüpfen können.

Auch religiöse Annahmen über Männlichkeit oder Weiblichkeit schaffen problematische Separatwelten, da sie Personen ausgrenzen, die sich nicht in die Ordnung «Mann-oder-Frau» einordnen wollen oder können. Bisher ist der Zusammenhang einer keineswegs überall anzutreffenden, aber dennoch verbreiteten «gender violence» in kirchlichen Kontexten gegen LGBTIQ-Personen wenig in den Blick genommen worden. Dies ist umso erstaunlicher, als das Risiko, Ziel sexualisierter Gewalt zu werden, für Trans-Personen und intergeschlechtliche Personen erhöht ist. Bereits im Kontext der Gewalt gegen Frauen und Kinder haben die Kirchen lange nichts an den Akzeptabilitätsbedingungen geändert. Denn dies hätte bedeutet, den eigenen Anteil an der Verachtung gegenüber Frauen, Kindern oder LGBTIQ-Personen zu problematisieren – beispielsweise gibt es bis heute häusliche Gewalt, die sich auf ein religiöses Ethos beruft – wie auch einen selbstbewussten und souveränen Umgang mit dem eigenen Körper zu thematisieren.
Sexualisierte Gewalt gegen nicht-binäre Personen, zum Beispiel solche, die sich als trans oder queer verstehen, oder gegen intergeschlechtliche Personen, kann sich gegen die blosse Tatsache ihres Soseins richten. Es kann ein «Grundgefühl, nicht korrekt zu sein» (Luna Born), vermittelt werden. Eine homo- und transphobe Atmosphäre macht LGBTIQ-Personen in kirchlichen Settings verletzlich und zu möglichen Zielen sexualisierter Gewalt, da ein selbstbewusster und selbstbestimmter Umgang mit dem eigenen geschlechtlichen Körper und der eigenen Sexualität durch moralische oder religiöse Verurteilungen erschwert wird.
Insgesamt zeigt das Buch auf, dass das Problem sexualisierter Gewalt in kirchlichen und religiösen Kontexten mit sehr verschiedenen Themenbereichen verquickt ist. Diese Erkenntnis ist von grosser Bedeutung für die Prävention: Erst wenn die Ermöglichungsstrukturen ernstgenommen und untersucht werden, so das Plädoyer, kann die Misere der sexualisierten Gewalt in kirchlichen Kontexten wirksam angegangen werden.
Medienmitteilung der Universität Bern, 25. Oktober 2021
«Neues Buch zu sexualisierter Gewalt in kirchlichen Kontexten»
Details zum Buch
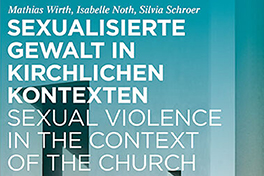
Details zum Buch
Wirth, Mathias, Noth, Isabelle, Schroer, Silvia. Sexualisierte Gewalt in kirchlichen Kontexten | Sexual Violence in the Context of the Church: Neue interdisziplinäre Perspektiven | New Interdisciplinary Perspectives, Berlin, Boston: De Gruyter, 2021. https://doi.org/10.1515/9783110699203
Über die Autorinnen und den Autor
Prof. Dr. Mathias Wirth ist Assistenzprofessor für Systematische Theologie/Ethik an der Theologischen Fakultät der Universität Bern und Leiter der dortigen Abteilung für Ethik.
Prof. Dr. Isabelle Noth ist Professorin für Seelsorge, Religionspsychologie und Religionspädagogik und Co-Direktorin des Instituts für Praktische Theologie an der Theologischen Fakultät der Universität Bern.
Prof. Dr. Silvia Schroer ist Professorin für Altes Testament (mit besonderer Berücksichtigung der biblischen Umwelt) an der Theologischen Fakultät der Universität Bern.