«Atemberaubende Diversität»: Die Evolution sozialer Vielfalt
Zehn Jahre lang hat Michael Taborsky mit zwei Kollegen an einem Grundlagenwerk über soziale Verhaltensstrategien gearbeitet. «The Evolution of Social Behaviour» wird in der Wissenschaftscommunity als Pflichtlektüre für alle am Thema Interessierte gewürdigt. «uniaktuell» hat mit ihm über das Buch gesprochen.

Zur Evolution des Sozialverhaltens wird enorm viel publiziert. Aber in meinen Augen fehlte immer eine Übersicht über den aktuellen Wissenstand und den Konsens unter den Fachleuten über zugrundeliegende Konzepte. Wir wissen zwar, dass die natürliche Selektion für die Vielfalt in der sozialen Organisation und im Sozialverhalten verantwortlich ist. Aber wie kann man erklären, dass die eigentlich sehr einfachen Prinzipien der natürlichen Selektion diese atemberaubende Diversität hervorbringen? Diesen Überblick wollte ich schaffen.
Wie sind Sie dazu vorgegangen?Mir war von Anfang an klar, dass ich das aufgrund der riesigen Materialfülle nicht alleine bewerkstelligen kann, und war darum sehr glücklich, zwei sehr renommierte Kollegen – Michael Cant von der University of Exeter und Jan Komdeur von der University of Groningen – für dieses Vorhaben gewinnen zu können. Wir haben uns für diese Aufgabe mit sehr unterschiedlichen Forschungs- und Erfahrungshintergründen bestens ergänzt.
Unsere individuelle Auseinandersetzung mit dem Thema hat eine sehr vielfältige Zugangsweise ermöglicht, sodass wir eine viel objektivere Perspektive erreichen konnten. Es war uns von Anfang an ein grosses Anliegen, nicht einfach unsere persönlichen Sichtweisen nebeneinanderzustellen, sondern daraus eine Synthese zu entwickeln, die den Stand des momentanen Wissens zu diesem Thema repräsentiert und auch als Lehrbuch dienen kann.
Damit wollten wir Studierenden, aber auch einem breiteren interessierten Publikum einen roten Faden durch unser Fachgebiet aufzeigen, der die Möglichkeit bietet, die Grundlagen der grossen Diversität, die uns Biologen und Biologinnen tagtäglich begeistert, besser verstehen zu lernen. Dass die Fachwelt uns nun attestiert, dass uns das bestens gelungen ist, freut uns natürlich sehr.
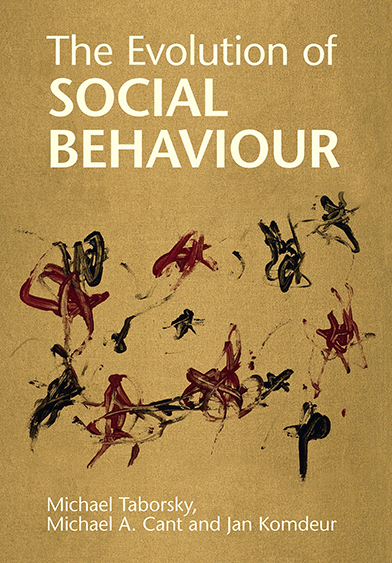
Letztendlich geht es immer darum, Strategien zu entwickeln, die Organismen in der Konkurrenz um Ressourcen erfolgreich machen. Dafür reichen ganz wenige Prinzipien aus. Sie sind sehr einfach verständlich, und wir kennen sie alle aus unserem eigenen täglichen «Konkurrenzkampf»: Es sind dies: erstens anderen zuvorzukommen – das Prinzip «um die Wette rennen». Zweitens Ressourcen zu monopolisieren – das Prinzip «Konflikt» beziehungsweise «Kampf». Oder drittens sich mit anderen zu verbünden – das Prinzip «Teilen» beziehungsweise «Kooperation». Alle Verhaltensstrategien, die im sozialen Umfeld eingesetzt werden, lassen sich in diese drei Grundprinzipien einordnen, das gilt für alle Lebewesen, von Bakterien bis zum Menschen. Welche dieser Strategien jeweils zu einer grösseren genetischen Fitness führt – denn darum geht es ja immer in der Evolution – hängt vom eigenen Zustand und von den ökologischen und sozialen Bedingungen ab.
Das heisst verkürzt: Es gibt drei Voraussetzungen, auf die mit drei generellen Verhaltensstrategien reagiert werden kann. Damit lässt sich alles soziale Verhalten erklären? Im Prinzip ja. Dass wir zeigen können, wie sich aus der unglaublichen Vielfalt von sozialem Verhalten – wir haben über 10’000 wissenschaftliche Artikel dafür berücksichtigt – einige wenige Strategien herauskristallisieren lassen, mit Hilfe derer sich Organismen in der Konkurrenz um Ressourcen bewähren können, hat uns auch sehr begeistert. Ich finde es rückblickend auch erstaunlich, dass bislang noch nicht erkannt wurde, welch einfache Prinzipien der Diversität sozialer Organisation zugrunde liegen, denn eigentlich liegen sie ja auf der Hand.
Man muss dazu sagen, dass die beiden ersten Prinzipien, also das Schneller-Sein und Monopolisieren, zwar einfach zu verstehen sind, es bei der Kooperation allerdings etwas komplizierter wird. Das Prinzip «Teilen» ist extrem weit verbreitet und hat ganz unterschiedliche Ausprägungsformen. Ein Grossteil der Fachliteratur beschäftigt sich mit dem Problem der Evolution kooperativen Verhaltens.
Können Sie uns die Funktionsweise der Kooperation etwas näher beschreiben?Die Höherentwicklung – nicht nur von sozialen, sondern auch von biologischen Organisationformen im Allgemeinen – kann nur durch die Selektionsvorteile der Kooperation erklärt werden. Dass sich zum Beispiel Zellen zu einem Verband zusammenschliessen, ist Voraussetzung dafür, dass überhaupt vielzellige Organismen entstehen können. Der menschliche Organismus besteht aus unzähligen Zellen, die zum Teil sehr verschiedene Aufgaben erfüllen, gemeinsam aber ein funktionierendes Individuum hervorbringen. Die Brutpflege ist im Bereich des Sozialverhaltens eine Aufgabe, die das Prinzip der Kooperation gut illustriert. Der Aufwand, den Eltern betreiben, um ihre Nachkommen zu versorgen, schränkt ihre Möglichkeiten weiterer Reproduktion ein, ist also altruistisch. Nachkommen erben die genetische Veranlagung zur Brutpflegebereitschaft und tragen sie in die nächste Generation. Es ist jedoch schwieriger zu verstehen, warum sich oft auch nicht-Verwandte an der Brutpflege beteiligen. Hier herrscht in der Regel das Prinzip der Gegenseitigkeit vor. «Teure» Hilfeleistung wird mitunter durch andere Vorteile, zum Beispiel durch gewährten Schutz oder den Zugang zu wichtigen Ressourcen, zurückbezahlt.
Sie wurden 2020 emeritiert. Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus?Für das kommende Jahr bin ich als Fellow an das Wissenschaftskolleg Berlin eingeladen worden. Dort möchte ich eine Arbeit zur Evolution von Gesellschaften – als Fortsetzung zu dem Buch, das jetzt gerade erscheint – in Angriff nehmen. Diese Arbeit soll in Kollaboration auch mit den Sozialwissenschaften entstehen. Zuerst aber freue ich mich auf mein Emeritierungs-Symposium Anfang September, zu dem wir neben meinen beiden Co-Autoren viele internationale Kolleginnen und Kollegen und ehemalige Mitarbeitende meiner Gruppe nach Bern einladen konnten.
Über Michael Taborsky

Prof. em. Dr. Michael Taborsky hat an der Universität Wien Biologie studiert, seine Dissertation am Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie in Seewiesen absolviert und 1992 an der Universität Wien habilitiert. 1993 bis 2000 war er Vizedirektor des Konrad-Lorenz-Instituts für vergleichende Verhaltensforschung in Wien. Seit 2000 ist er Professor für Verhaltensökologie an der Universität Bern. Seine Forschung konzentriert sich auf die evolutionären Prinzipien, die verschiedenen Verhaltensstrategien zugrunde liegen, wobei er empirische Untersuchungen an Insekten, Spinnen, Fischen, Vögeln und Säugetieren mit theoretischen und konzeptionellen Ansätzen verbindet. Er ist seit August 2020 emeritiert und ab September 2022 Fellow des Wissenschaftskollegs zu Berlin.
Über das Buch «The Evolution of Social Behaviour»
Michael Taborsky; Michael A. Cant; Jan Komdeur: The Evolution of Social Behaviour. Cambridge University Press, 2021 Wie lässt sich die erstaunliche Vielfalt der sozialen Systeme und Verhaltensweisen in der Natur erklären? Was sind die grundlegenden Prinzipien der sozialen Evolution, die diesem phänomenalen Reichtum zugrunde liegen? Gemeinsam mit Mike Cant (Universität Exeter) und Jan Komdeur (Universität Groningen) hat Michael Taborsky von der Universität Bern den derzeitigen Wissensstand und das Verständnis der allgemeinen evolutionären Prinzipien zusammengefasst, die dem sozialen Verhalten zugrunde liegen. Mit einem breiten Fokus, der von Mikroorganismen bis zum Menschen reicht, zielt das Buch darauf ab, eine umfassende Darstellung der Evolution von Sozialität durch natürliche Selektion zu liefern. Das Buch erscheint in englischer Sprache. (Quelle: Klappentext des Buches, Cambridge University Press)
Zur Autorin
Nicola v. Greyerz arbeitet als Eventmanagerin in der Abteilung Kommunikation & Marketing der Universität Bern.