Richtig evaluieren
Die richtigen Dinge tun, und diese Dinge richtig tun: Wie gelingt das? Lernen kann man es in den CAS-, DAS- und MAS-Weiterbildungsstudiengängen zum Thema Evaluation am Zentrum für universitäre Weiterbildung ZUW der Universität Bern. Im Interview zur zehnten Durchführung erklärt Studienleiterin Verena Friedrich, wie man richtig evaluiert und was es dazu braucht.
«uniaktuell»: Was macht eine gute Evaluation aus?
Verena Friedrich: Evaluation bedeutet ganz grundsätzlich, ein Projekt, ein Gesetz oder eine sonstige Massnahme auf der Grundlage empirischer Daten zu bewerten. Als Beispiel: Was bringt ein Gesetz zum Schutz vor Passivrauchen? Nimmt damit die Zahl der Lungenkrebsfälle ab, oder führt es nur dazu, dass Restaurantbetriebe Einbussen haben? Diese Fragen kann man nur seriös beantworten, wenn man auf systematische Evaluationen zurückgreift. Gute Evaluationen zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Gegenstand eindeutig abgrenzen, klare Fragestellungen formulieren, Bewertungskriterien benennen, Daten regelgeleitet erheben und auswerten, und die Fragestellungen nachvollziehbar beantworten.

In welchen Bereichen ist Evaluation sinnvoll?
Gegenstand von Evaluationen sind vor allem Massnahmen, die öffentlich verantwortet und oder finanziert werden. Typische Anwendungsfelder finden sich in Politik und Verwaltung, im Bildungs-, Sozial- und Gesundheitswesen, im Umwelt- und Kulturbereich oder in der Entwicklungszusammenarbeit. Dabei beziehen sich Evaluationen nicht nur auf Wirkungen, Projektergebnisse oder die Zielerreichung. Ebenso können sie sich auf Umsetzungsprozesse oder auf die Voraussetzungen für ein Vorhaben beziehen. Zum Beispiel: Ist ein Projektplan realistisch?
Kann man auch zu viel evaluieren?
Allerdings! Der Begriff Evaluation hat sich in den letzten Jahren stark verbreitet. Er wird in verschiedenen Bereichen unterschiedlich und teilweise inflationär verwendet. Dort, wo Evaluation zum blossen Ritual wird und «Datenberge» angehäuft werden, wird sie zu Recht kritisiert. Damit sich eine nachhaltige, positive Evaluationskultur entwickeln kann, ist es wichtig, dass Evaluationen eben gezielt eingesetzt werden und aus Evaluationsergebnissen sichtbare Veränderungen entstehen. Dafür muss die gesamte Evaluation von Anfang an an den Informationsbedürfnissen derjenigen ausgerichtet sein, die die Ergebnisse letztendlich auch nutzen wollen.
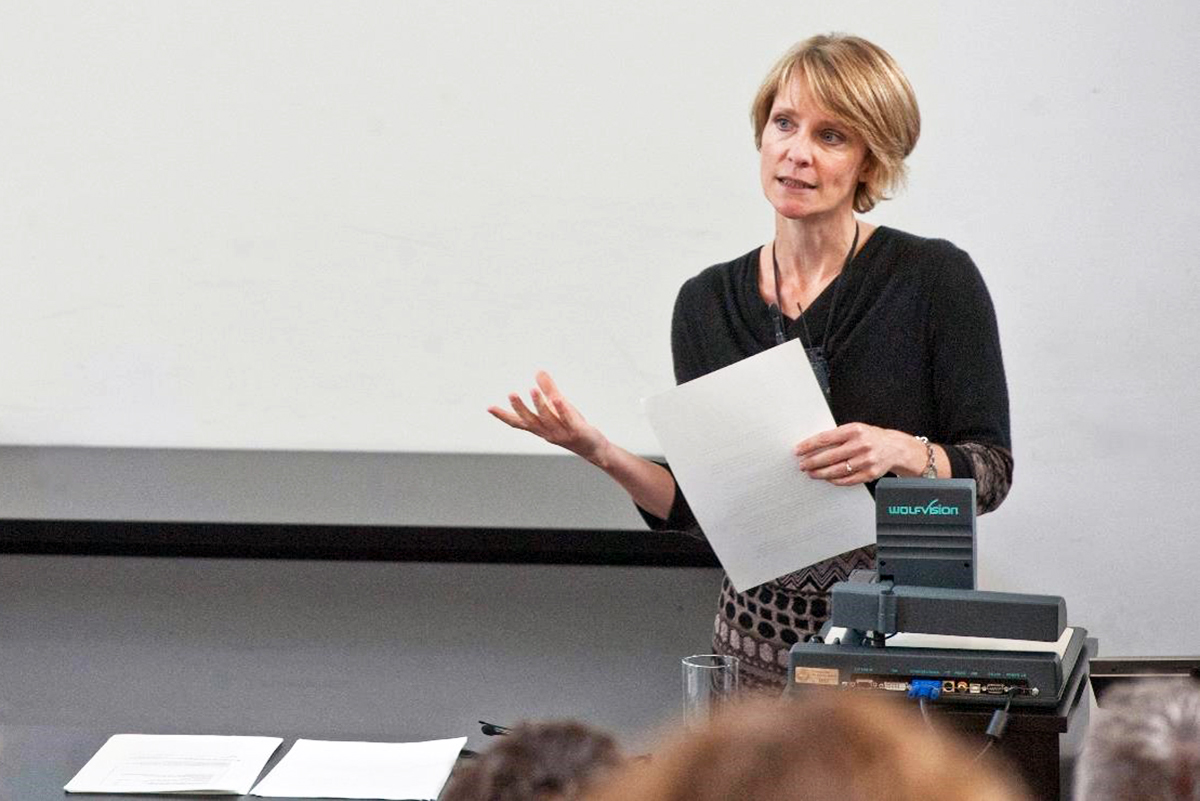
Kommen wir zur den Evaluationsstudiengängen am ZUW. Für wen ist eine solche Weiterbildung das Richtige?
Der CAS Evaluation richtet sich an Personen, die Evaluationen in Auftrag geben oder das Management von Evaluationen in Organisationen verantworten. Dies sind zum Beispiel Mitarbeitende der (Bundes-)Verwaltung oder von Stiftungen. Der DAS richtet sich an Personen, die im Auftrag von Dritten oder organisationsintern, zum Beispiel in Hochschulen oder Spitälern, Evaluationen durchführen. Der MAS richtet sich an Personen, die sich hauptsächlich mit Evaluation beschäftigen und die sich nicht nur mit dem «Wie», sondern auch mit übergeordneten Aspekten wie der Führung im Evaluationskontext oder der Organisationsentwicklung befassen möchten.
Welche Vorteile bringt die Weiterbildung im Arbeitsalltag?
Unsere Teilnehmenden melden uns zurück, dass sie von verschiedenen Aspekten profitieren: Zum einen ist da natürlich der Wissenszuwachs. Weiter profitieren sie aber auch von konkreten Tools, Modellen und Ansätzen, die sie in eigenen Projekten direkt anwenden können sowie auch von den Vernetzungsmöglichkeiten mit anderen Teilnehmenden und Dozierenden.
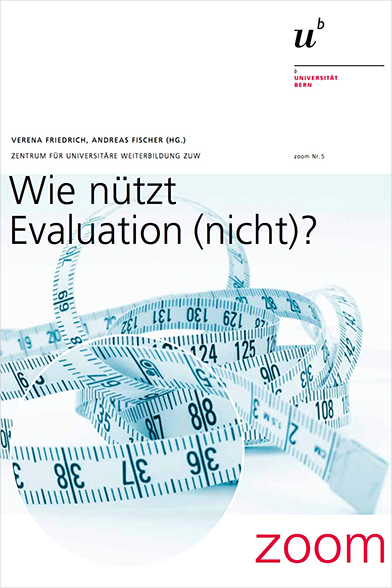
Was wünschen Sie sich für die nächsten zehn Durchführungen?
Weiterhin so interessierte und engagierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie bisher! Ausserdem wünsche ich mir ein noch breiteres Bewusstsein dafür, was eine gute Evaluation ausmacht, welche Kompetenzen dafür notwendig sind, und was das Evaluationsstudium an der Universität Bern dazu beitragen kann.
Zur Person

Dr. Verena Friedrich leitet den Bereich Evaluation am Zentrum für universitäre Weiterbildung ZUW der Universität Bern. Sie ist Studienleiterin des CAS, DAS und MAS, führt Evaluationen und Evaluationsberatungen durch und bietet themenspezifische Weiterbildungen im Auftrag an. Mit ihrem Team ist sie auch in der Forschung über Evaluation aktiv. Vor ihrer Tätigkeit an der Universität Bern war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Projektleiterin an der ETH Zürich und der Universität Zürich mit Evaluationen im Bereich Neue Technologien und Gesundheitsförderung befasst. Sie hat an der Universität Konstanz Psychologie studiert mit dem Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie.
Kontakt
Dr. Verena Friedrich
Universität Bern
Zentrum für universitäre Weiterbildung ZUW
Telefon: +41 31 631 53 37
verena.friedrich@zuw.unibe.ch
Zentrum für universitäre Weiterbildung ZUW
Das Zentrum für universitäre Weiterbildung ZUW der Universität Bern ist Ansprechpartner in allen Fragen der wissenschaftlichen Weiterbildung. Das ZUW unterstützt einerseits die Fakultäten und Institute der Universität Bern bei der Planung, Organisation, Bewerbung, Durchführung und Evaluation von Weiterbildungsprogrammen. Zudem bietet das ZUW eigene Weiterbildungen an. Inhaltliche Schwerpunkte sind die Bereiche Evaluation, Forschungsmanagement und Hochschuldidaktik & Lehrentwicklung. Auch in der weiterbildungsrelevanten Forschung ist das ZUW engagiert.
Bereich Evaluation am ZUW
Der Bereich Evaluation am ZUW befasst sich unter verschiedenen Blickwinkeln mit Evaluation. Das Angebot umfasst neben Studiengängen und Kursen auch Forschung und verschiedene Dienstleistungen rund um das Thema Evaluation.
Die Weiterbildungsstudiengänge zum Thema Evaluation, die das ZUW seit 2002 anbietet, wurden stetig weiterentwickelt und sind heute in drei gestufte Universitätsabschlüsse (CAS, DAS, MAS) aufgeteilt. Alle Kurse können auch einzeln besucht werden.
Zum Autor
Ivo Schmucki arbeitet als Redaktor bei Corporate Communication an der Universität Bern.