Hochdekoriert und neugierig wie eh und je
Der grosse alte Mann der amerikanischen Politologie, Robert Keohane, sprach am Oeschger-Zentrum für Klimaforschung an der Universität Bern über fehlende Erfolge in der internationalen Klimapolitik – und er schonte dabei auch seine eigene Zunft nicht.
Er kam nach Bern, um einen hochdotierten Scheck abzuholen, und er wollte junge Forschende für ein neues internationales Projekt gewinnen: Der Politologe Robert Keohane, 76, Professor für internationale Beziehungen an der Universität Princeton und einer der ganz grossen seines Fachs, insbesondere in der Theorie der Internationalen Beziehungen.

Nach einer Reihe von Auszeichnungen hat Keohane 2016 den Balzan Preis für «Internationale Beziehungen, Geschichte und Theorie» erhalten, der ihm – zusammen mit weiteren Preisträgerinnen und -trägern – am 17. November 2017 in Bern verliehen wurde. Der mit 750’000 Franken dotierte Preis gehört zu den weltweit wichtigsten wissenschaftlichen Auszeichnungen. Doch am Tag bevor Robert Keohane im Bundeshaus im Beisein von Bundespräsidentin Doris Leuthard seine Auszeichnung entgegennahm und mit einem Diner im Hotel Bellevue geehrt wurde, nahm er sich Zeit für akademischen Gedankenaustausch. Auf Einladung des Oeschger-Zentrums für Klimaforschung hielt er an der Universität Bern einen Vortrag mit anschliessender Diskussion.
Klimaziele ohne USA noch schwieriger zu erreichen
«Designing a global climate regime without US leadership», so lautete das Thema des Referats. «Schon nur dieser Titel macht mich sehr wütend», meinte der amerikanische Politologe zum Einstieg. Machte dann aber auch gleich klar, dass das amerikanische Vorangehen in der Klimapolitik schon immer verhalten und innenpolitisch schwierig gewesen sei. «Die Ziele des Klimaabkommens von Paris zu erfüllen sind schwierig genug – ohne die USA wird es noch härter.»

In seinem Vortrag lieferte Robert Keohane einen Abriss über die bisherige globale Klimapolitik und verglich sie mit dem Montreal-Protokoll. Dem multilateralen Abkommen, das Stoffe verbietet, die zum Abbau der Ozonschicht führen, und das als eine der grossen Erfolgsgeschichten der internationalen Umweltpolitik gilt. Dabei betonte er, dass es für das Zustandekommen von internationalen Abkommen keine Harmonie brauche, denn Zusammenarbeit werde nur dort notwendig, wo Uneinigkeit über ein Problem besteht. Der Politologe sieht den Schlüssel zum Erfolg in richtig gesetzten Anreizen. «Die kurze Version der ganzen Geschichte: Wo die institutionellen Anreize richtig gesetzt sind, klappt es auch mit dem internationalen Klimaschutz.»
Schlechtes Beispiel Kyoto-Protokoll
Die etwas ausführlichere Erklärung des Erfolgs des Protokolls von Montreal: Das Verbot von Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) als Treibgase und Kühlmittel liess sich gut überwachen, und es setzte Anreize, alternative Technologien zu entwickeln. Vor allem aber wurden nicht nur die Industrie-, sondern auch die Entwicklungsländer in die Pflicht genommen. Sie durften sich beim Verzicht auf ozonschädigende Stoffe lediglich mehr Zeit lassen. Im Gegensatz dazu, so Keohane, habe das Kyoto-Protokoll zum Klimaschutz gezeigt, «wie man es nicht machen sollte». Hauptkritikpunkt: Die Entwicklungsländer waren darin permanent von Klimaschutzmassnahmen ausgenommen – auch China, das heute Seite an Seite mit den USA am meisten Treibhausgase verursacht.
Dass sich im Abkommen von Paris alle Staaten zu Reduktionsmassnahmen bekennen müssen, wertet der Spezialist für internationale Beziehung als strategisch richtig. «Es war klug, zuerst alle Staaten an Bord zu bekommen und erst danach daran zu arbeiten, das Abkommen verbindlicher und effektiver zu gestalten.» Wie schwierig allerdings dieser zweite Schritt ist, zeigte sich an der soeben abgeschlossenen Klimakonferenz in Bonn – sie befand sich noch in vollem Gang, als Robert Keohane in Bern zu Gast war.
Wie kommt gute Klimapolitik zu Stande?
Nach seinem rasanten Überblick zur Klimapolitik wandte sich der Balzan Preisträger einem Punkt zu, der ihm besonders am Herzen liegt. Auf Wunsch der Balzan Stiftung soll die Hälfte des Preisgelds zur Förderung von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingesetzt werden, und so stellte Robert Keohane im zweiten Teil seines Auftritts denn auch gleich ein entsprechendes Forschungsvorhaben zur Diskussion. Er sei nicht zufrieden damit, was seine Disziplin bis heute zur Bekämpfung des Klimawandels beigetragen habe. Dem will Keohane nun mit einem grossangelegten Projekt in vergleichender Politikwissenschaft entgegentreten, denn es fehle schlicht an Wissen darüber, wie Klimapolitiken zustande kämen. «Wir verstehen zwar gut, wie etwa Industriepolitik oder Sozialschutz unterschiedlich angegangen werden, aber haben keine Ahnung, weshalb gewisse Staaten effektive Klimapolitik verfolgen und andere nicht.» Wichtige sei aber auch zu wissen, warum Städte, Regionen, oder Unternehmen ambitionierte Entscheide zur CO2-Reduktion fällten.

Er wünsche sich, möglichst viele junge Forschende würden sich diesen Fragen zuwenden, warf Robert Keohane in die vollbesetzten Ränge des Hörsaals im Unitobler-Gebäude. Schliesslich könne mit doppelter Belohnung rechnen, wer sich in diesem noch unbeackerten Feld der Klimapolitik engagiere: «Stipendien für euch und eine bessere Klimapolitik für uns alle.»
ZUR PERSON
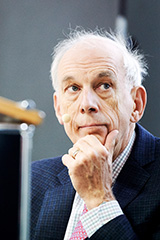
Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Robert Owen Keohane (* 3. Oktober 1941 in Chicago, Illinois) ist Professor für «International Affairs» der Woodrow-Wilson-Fakultät der Princeton University. Keohane gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der zeitgenössischen Theorie der Internationalen Beziehungen. 2016 wurde er mit dem Balzan Preis ausgezeichnet.
DAS OESCHGER-ZENTRUM FÜR KLIMAFORSCHUNG (OCCR)
Das Oeschger-Zentrum ist das Kompetenzzentrum der Universität Bern für Klimaforschung. Es wurde im Sommer 2007 gegründet und trägt den Namen von Hans Oeschger (1927-1998), einem Pionier der modernen Klimaforschung, der in Bern tätig war. Das Oeschger-Zentrum bringt Forscherinnen und Forscher aus neun Instituten und vier Fakultäten zusammen und forscht disziplinär und interdisziplinär an vorderster Front. Erst die Zusammenarbeit von Natur-, Human-, Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften kann Wege aufzeigen, wie sich dem globalen Klimawandel auf unterschiedlichsten Ebenen begegnen lässt: regional verankert und global vernetzt.
ZUM AUTOR
Kaspar Meuli ist Journalist und PR-Berater. Er ist verantwortlich für die Kommunikation des Oeschger-Zentrums für Klimaforschung.