Im Zeichen der Nachhaltigkeit
Hans Hurni ist Professor für Geographie und nachhaltige Entwicklung, ehemaliger Direktor des Nationalen Forschungsschwerpunkts Nord-Süd (NCCR North-South) und Gründungspräsident des Centre for Development and Environment (CDE) an der Universität Bern. Der ausgewiesene Experte auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit wird 2016 pensioniert. Im Interview reflektiert er über das Erreichte und erzählt vom Nachhaltigkeitstag, der am Freitag, 20. November unter dem Motto «Schnelllebigkeit vs. Nachhaltigkeit» an der Uni Bern stattfindet.
Welche Themen werden am Nachhaltigkeitstag im Zentrum stehen?
Der Nachhaltigkeitstag 2015 dauert eigentlich eine ganze Woche und thematisiert unsere Schnelllebigkeit als Gegenpol zur Nachhaltigkeit. Im Vorfeld der eigentlichen Tagung werden vom studentischen Verein für Nachhaltige Entwicklung (BENE) verschiedene Anlässe organisiert. Am Montag bietet der Berner No-Foodwaste-Koch Mirko Buri in der Mensa Gesellschaftsstrasse ein Mittagsmenü an, bei dem möglichst wenig Abfall produziert wird; am Dienstag ab 18:30 Uhr gibt es ein Symposium zu «Wirtschaft auf der nachhaltigen Erfolgswelle», und am Freitag kocht wiederum Mirko Buri während der Tagung, diesmal in der Mensa VonRoll.
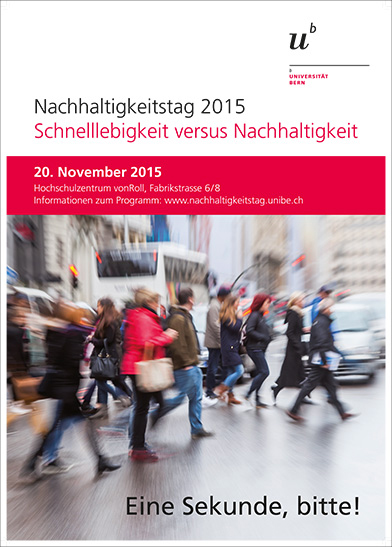
Wie sollen die Besucherinnen und Besucher fürs Thema sensibilisiert werden?
Der Nachhaltigkeitstag am Freitag ist gefüllt mit Workshops, Referaten und Paneldiskussionen. Diese eher traditionellen Formate sind untermalt von einer Entschleunigungsshow des Künstlers Baldrian, einer Führung durch das VonRoll Areal sowie entspannender Musik von Pink Pedrazzi & Mike Bischof. Die Tagung verspricht nicht nur, Wissen zu vermitteln, sondern es sollen Erfahrungen ausgetauscht und die verschiedenen Sinne angesprochen werden. Die Organisatoren versprechen sich davon ein nachhaltigeres Lernen, das zur Nachahmung und Weitergabe des Gelernten anregen soll.
Das Centre for Development and Environment (CDE) ist Mitorganisatorin des Nachhaltigkeitstags. Sie waren Mitbegründer und Präsident des CDE. Können Sie etwas darüber erzählen, warum das CDE im Jahr 2009 gegründet wurde?
Im Wesentlichen trugen drei Faktoren dazu bei, dass es zur Gründung dieses universitären Zentrums für nachhaltige Entwicklung und Umwelt kam: Erstens hat die Uni 2009 einen neuen Leistungsauftrag der Berner Regierung erhalten, in welchem explizit gefordert wurde, dass sie sich vertieft mit nachhaltiger Entwicklung auseinandersetzt. Das Thema war zum damaligen Zeitpunkt schon seit über 20 Jahren international verhandelt worden, und die Regierungen der meisten Länder waren seit dem Erdgipfel in Rio de Janeiro von 1992 damit einverstanden, sich für eine global nachhaltigere Entwicklung einzusetzen. Zweitens hat das Geographische Institut seit 1988 die Forschungsrichtung «Entwicklung und Umwelt» mit einem Fokus auf Entwicklungsländer betrieben, die ich mitleiten durfte. Drittens ist es uns gelungen, anlässlich der ersten Serie der nationalen Forschungsschwerpunkte den sogenannten NCCR North-South zu akquirieren. Die NCCRs sollten auch zur Strukturbildung an ihren Heiminstitutionen dienen. Diese drei Faktoren liefen 2009 optimal zusammen, so dass der damalige Rektor, Prof. Urs Würgler, die Gründung des CDE wie auch anderer Zentren vorantrieb.
Von 2001 bis 2013 war der von Ihnen eben erwähnte nationale Forschungsschwerpunkt Nord-Süd (NCCR North South) an der Uni Bern angesiedelt. In dieser Zeit sind innerhalb des NCCR rund 2'300 Publikationen mit Forschungsergebnissen entstanden. Wie sieht es mit der praktischen Umsetzung dieser Ergebnisse aus? Mündeten diese in konkrete Projekte in Entwicklungsländern?
Selbstverständlich. Im Rahmen des NCCR North-South hatten wir mehr oder weniger freie Hand, nicht nur Forschung zu betreiben, sondern die Resultate auch zu testen. Wir schufen ein Gefäss, in welchem die Forschenden ihre Resultate in konkreten Projekten umsetzen konnten. Pro Projekt hatten sie einen Betrag von bis zu CHF 50‘000.00 zur Verfügung, unter der Bedingung, dass die Projekte gemeinsam mit den Betroffenen entwickelt und durchgeführt wurden. Insgesamt haben wir in den 12 Jahren des Programms über 60 Umsetzungsprojekte realisiert, und zwar in allen Bereichen der nachhaltigen Entwicklung, zum Beispiel in der Verbesserung von Gesundheitssystemen, in Umwelthygiene, Stadtentwicklung, Ressourcennutzung oder der Verbesserung der Lebensumstände und der politisch-institutionellen Rahmenbedingungen. Das Beste an diesen Projekten war, dass sie auch zurück in die Forschung wirkten und unsere Vorgehensweisen zu verbessern halfen.
Sind die Forschungsnetzwerke, die dank dem NCCR entstanden sind, ein Ausdruck von gelebter Nachhaltigkeit?
Leider nein. Zwar war es uns neben der Innovation in der Forschung ein grosses Anliegen, möglichst viele Stipendiaten aus Entwicklungs- und Transitionsländern vor Ort auszubilden und gleichzeitig eine hohe Qualität der Forschung zu sichern. Die Netzwerke, die wir aufgebaut haben, sind allerdings heute, gut zwei Jahre nach Abschluss des Programms, nur noch informell vorhanden, denn es war nicht die Absicht der Geldgeber, permanente Netzwerke zu finanzieren.
Sie waren selbst viel im Ausland unterwegs und haben auch viele Jahre in Äthiopien gelebt und gearbeitet. Was können wir von solchen Ländern lernen?
Ich bin immer wieder verblüfft, mit wieviel Würde die Menschen in Ländern wie Äthiopien mit ihrer Armut umgehen; wie freigiebig sie das Wenige, was sie haben, mit ihren Gästen teilen; wie sie bereit sind, Neues auszuprobieren und damit auch oft Risiken einzugehen.

Was war Ihre persönliche Motivation, in all den Jahren auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit tätig zu sein?
Ich hatte stets grosse Vorbilder in meinem beruflichen und privaten Werdegang, die mich unterstützten, anregten und mir immer wieder neue Wege zeigten.
Inwiefern bleiben Sie dem Thema und der Uni Bern nach Ihrer Pensionierung verbunden?
Erst einmal werde ich mein Büro und meine Archive am CDE räumen, um meinen Nachfolgern Platz zu machen. Die Forschung, die Betreuung von rund einem Dutzend Doktorierenden und die Mitleitung eines grossen Gebirgsinstituts im Himalaya werde ich aber hoffentlich noch einige Jahre weiter betreiben können.
Zur Person

Hans Hurni ist in Erlenbach im Simmental aufgewachsen und hat an der Universität Bern Geographie, Mathematik und Geologie studiert. Nach rund drei Jahren Feldaufenthalt in Äthiopien promovierte er 1980 zu Klimawandel und Umweltproblemen, worauf er mit seiner Familie nochmals 7 Jahre in diesem krisengeschüttelten Land verbrachte und schliesslich 1991 zum Thema Bodenerosion und nachhaltige Bodennutzung an der Philosophisch-naturwissenschaftlichen Fakultät habilitierte. Von 2001 bis 2013 leitete er den Nationalen Forschungsschwerpunkt «NCCR North-South»; er begründete 2009 das interdisziplinäre Zentrum für nachhaltige Entwicklung und Umwelt (CDE) der Universität Bern sowie die Internationale Graduiertenschule «IGS North-South» der Universitäten Bern, Basel und Zürich.
Kontakt:
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Hurni
Geographisches Institut, Integrative Geographie
Hallerstrasse 10
3012 Bern
hans.hurni@cde.unibe.ch
http://www.cde.unibe.ch/about_us/personen/prof_dr_hurni_hans/index_eng.html
Zum Nachhaltigkeitstag der Uni Bern
Die Universität Bern organisiert nach dem erstmaligen «Sustainable University Day 2014» regelmässig einen Nachhaltigkeitstag, um Themenschwerpunkte rund um die Nachhaltigkeit an der Universität sichtbar zu machen und zu verankern. Der Anlass geht unter anderem der Frage nach, wie nachhaltige Entwicklung in Studiengänge Eingang finden kann, thematisiert ihre Verankerung auf der strategischen und betrieblichen Ebene der Universität und diskutiert den Nutzen einer ökonomisch, sozial und ökologisch nachhaltigen Entwicklung für die Gesellschaft.
Organisiert wird der Nachhaltigkeitstag vom Vizerektorat Qualität der Universität Bern, dem CDE und dem Verein an der Universität für Nachhaltige Entwicklung (BENE).