«Die Hoffnung bleibt»
Die Veranstaltung «Syrien – Kulturland und Kriegsgebiet» mit drei Experten der Uni Bern ist auf grosses Interesse gestossen: der Saal in der UniS füllte sich am Samstag, 28. November, bis auf den letzten Platz. Im Zentrum der Referate standen die Kulturgüterzerstörung sowie der historische und kulturelle Hintergrund der Konflikte in der Region.
Das Land Syrien ist vielen ein Begriff, den meisten von uns aufgrund der seit Jahren wiederkehrenden Schlagzeilen über den Bürgerkrieg. Doch Syrien ist mehr als nur ein Kriegsgebiet: Syrien ist auch ein Kulturland mit unzähligen antiken Stätten und einem bedeutsamen kulturellen Erbe.

Zerstörung des kulturellen Erbes und Strategien für den Wiederaufbau
Das wird klar, wenn Prof. Mirko Novák über Syrien spricht, der selbst über 25 Jahre lang an archäologischen Grabungen vor Ort teilgenommen hat. Für den Zuhörenden breitet sich vor dem inneren Auge die Euphrat-Ebene aus, das fruchtbare Oasen-Gebiet und Teil Mesopotamiens, dem die Menschheitsgeschichte die ersten Städte und die Verbreitung der ältesten Schriften verdankt. Prof. Novák spricht auch über die Kulturgüterzerstörung und den illegalen Handel mit Kulturgütern, welche seit Kriegsbeginn stattfinden. Einerseits geschehen die Zerstörungen am Rande der Kampfhandlungen als Kollateralschäden, andererseits wird aus Not mit den antiken Kunstschätzen Handel getrieben. Und schliesslich wird die Zerstörung des kulturellen Erbes von der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) ideologisch instrumentalisiert und propagandistisch ausgeschlachtet. Doch auch dem IS dient der Handel mit kleineren Objekten als wichtige Finanzierungsquelle.

Prof. Novák benennt am Ende seines Vortrages Strategien für den Erhalt des Weltkulturerbes und für dessen Wiederaufbau nach Kriegsende sowie für sofortige Massnahmen zur Eindämmung des illegalen Handels mit Kulturgütern.
Das Volk im Stich gelassen
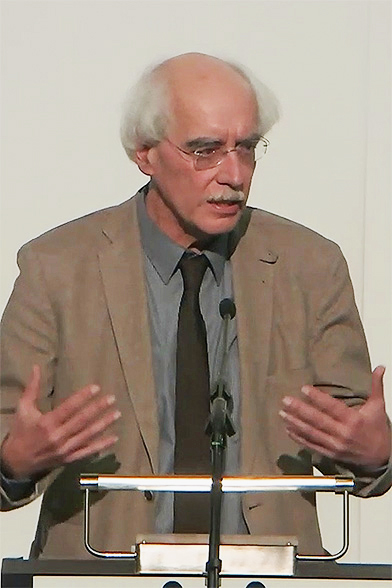
Prof. Reinhard Schulze zeichnet ein düsteres Bild vom bürgerkriegsgeprägten Land. Syrien habe innerhalb von fünf Jahren einen Viertel seiner Bevölkerung verloren. Die Opferzahlen sind dreimal höher und die Zahl der Flüchtlinge gar achtmal höher verglichen mit dem Jugoslawienkrieg von 1991-2000. Der IS kontrolliert gemäss Prof. Schulze heute 18 Prozent des Landes, das Regime noch 16 Prozent, die Opposition 7 Prozent und die Kurden 6 Prozent, der restliche Teil ist dünn besiedeltes Wüstengebiet. Vom ursprünglichen Konflikt zwischen Regime und Opposition, dem Kampf für Demokratie und eine offene Gesellschaft, sei heute nicht mehr viel übrig. Dieser Konflikt, welcher im Zuge des Arabischen Frühlings aufgeflammt sei, habe auf einem wesentlichen Problem beruht: Das Regime unter Präsident al-Assad kontrolliere 75 Prozent des Bruttoinlandproduktes. De facto braucht das Regime also sein eigenes Volk nicht mehr. «Es existiert keine Regierung, kein Militär, keine Polizei zum Schutz der Bevölkerung. Das heisst, es gibt und gab in Syrien keine Zivilgesellschaft, wie sie für uns Europäer selbstverständlich ist.» Schon kurz nach Beginn des Bürgerkriegs herrschten in Syrien unhaltbare Zustände. Der bewaffnete Aufstand gegen das Regime müsse daher weniger als Angriffsbewaffnung, sondern vielmehr als Verteidigungsbewaffnung eines Volkes verstanden werden, das von seiner Regierung im Stich gelassen worden sei.
Einstmals ein farbiges Mosaik
Diese Aussagen untermauert Mohamad Fakhro in seinem Referat über den Alltag im Bürgerkrieg, den er als gebürtiger Syrer bis zu seiner Flucht selbst miterlebt hat.

Willkürliche Bedrohung ging von bewaffneten Banden, aber auch vom Regime selbst aus. Fakhro selbst musste für seinen Arbeitsweg ins Stadtzentrum Aleppos täglich sein Leben riskieren. Einerseits aufgrund der Bombardements, anderseits drohte ihm an den unzähligen Checkpoints des Militärs jederzeit die Verhaftung. Fakhro berichtet auch über das Elend in den Flüchtlingscamps, das er mit eigenen Augen gesehen hat. Die Menschen dort lebten von weniger als Nichts. Und dennoch, die Hoffnung bleibe. Selbst in den Flüchtlingscamps fände Schulunterricht statt, Bildung sei für die Syrer ein kostbares Gut. «Vor dem Krieg war Syrien ein farbiges Mosaik, zusammengesetzt aus ganz unterschiedlichen ethnischen Gruppen und Religionen, ein Land in dem ein friedliches Zusammenleben über Jahrhunderte hinweg funktioniert hat.»
Beitrag zum Verständnis und zur Toleranz
Dass dieser Krieg enden muss, darüber sind sich alle drei Referenten einig. Wie Prof. Schulze vermerkte, ist Syrien längst zu einer internationalen Kampfbühne geworden, in einem dafür offenen Territorium, das keine staatliche Macht mehr schützt: «Hier werden Interessen ausgefochten, welche mit Syrien nichts mehr zu tun haben.» Einen Überblick über die unterschiedlichen Konfliktparteien zu behalten ist indessen schwierig. Spätestens seit dem militärischen Eingreifen Russlands zur Rückendeckung des Regimes von Bashr-al-Assad, welches dem militärischen Engagement der USA auf Seiten der Opposition diametral entgegensteht, wurde der Konflikt zu einer globalen Angelegenheit. Das Wirken des IS verwischt die Trennlinie zwischen den Konfliktparteien noch mehr. Nach den Anschlägen in Paris erstarkt auch der Ruf nach einem gemeinsamen militärischen Vorgehen der westlichen Mächte. Der Erfolg einer solchen Aktion ist dagegen mehr als unsicher. Das militärische Eingreifen der USA hat die Region bisher nur weiter destabilisiert. Opfer des Krieges ist die Zivilbevölkerung, welche verständlicherweise und aus tiefer Not aus den Kampfzonen flüchtet. Denn diese beschränken sich nicht auf unbewohntes Gebiet, vielmehr finden sie mitten in Städten und Dörfern statt. Mit den Flüchtlingen ist das Thema definitiv auch in Europa angekommen.

Das Wissen über die Bevölkerung und das Land Syrien sowie über die unhaltbaren Zustände im Kriegsgebiet, welches von den drei Referenten vermittelt wurde, ist von grosser Bedeutung für das Verständnis und die Toleranz gegenüber den Ankommenden.
Das grosse Interesse an der Veranstaltung war für alle Beteiligten sehr positiv. Die Universität Bern sieht sich in der Pflicht, zu gesellschaftspolitischen Ereignissen dieses Ausmasses Informationen zu vermitteln und den Dialog zu fördern. Besonders erfreulich ist daher, dass Prof. Novák direkt nach der Veranstaltung eine Anfrage von der US-Botschaft erhalten hat: Sein Expertenwissen ist gefragt für eine Initiative zur Eindämmung des illegalen Handels mit Kunstgütern aus Kriegsgebieten.
Videoaufzeichnung
Die Videoaufzeichnung der Veranstaltung ist auf der folgenden Seite online abrufbar:
Zu den Referenten
Prof. Reinhard Schulze (geb. 1953) ist seit 1995 Professor für Islamwissenschaft und Neure Orientalische Philologie an der Universität Bern sowie Direktor des Instituts. Er habilitierte 1987 in Bonn und forscht u.a. im Bereich islamische Kultur- und Religionsgeschichte. Schwerpunkt seiner aktuelleren Forschung sind die zeitgenössischen islamisch-politischen Kulturen. Prof. Schulze gilt schweizweit als Islam-Experte.
Prof. Mirko Novák (geb. 1965) hat an der der Universität Tübingen habilitiert und ist seit 2011 Professor für Vorderasiatische Archäologie an der Universität Bern. Er war 25 Jahre lang an zahlreichen Ausgrabungsprojekten in Syrien beteiligt. Prof. Novák setzt sich gegen die Kulturgüterzerstörung ein, u.a. im internationalen Komitee von shirín (Syrian Heritage in Danger: an International Research Initiative, shirin-international.org).
Mohamad Fakhro (geb. 1977) war bis zu seiner Flucht Vize-Direktor des Nationalmuseums in Aleppo (Syrien) und Leiter des dortigen Ausgrabungsdepartements. Er hat den Bürgerkrieg in Syrien mehrere Jahre miterlebt und einen wesentlichen Beitrag zum Schutz des Kulturerbes geleistet. Mohamad Fakhro ist Doktorand am Institut für Archäologische Wissenschaften der Universität Bern und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Projekt “Ausgrabungen in Tell Halaf/Guzana“ der Universität Tübingen.
Zur Veranstaltung
Die Veranstaltung zu Syrien wurde in Zusammenarbeit mit den Referenten und mit Unterstützung der Unileitung organisiert. Gemeinsam mit dem Collegium Generale ist für das Frühjahr 2016 eine grössere Veranstaltungsreihe zum Thema «Flucht, Migration, Integration» geplant. Experten der Universität Bern aus unterschiedlichen Wissenschaftsgebieten werden der Frage nach möglichen Lösungsansätzen und Chancen der aktuellen Krise nachgehen.
Zur Autorin
Vera Knöpfel ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Rektor Martin Täuber und hat die Veranstaltung initiiert. Sie hat an der Universität Bern Geschichte und Germanistik studiert und danach mehrere Jahre für die Eidgenössischen Parlamentsdienste gearbeitet.