Zebrastreifen im Kopf
So harmlos die gelben Balken aussehen – was beim Überqueren einer Strasse im Gehirn abläuft, gleicht einem Feuerwerk der Synapsen, den Schaltstellen zwischen den Nervenzellen. Forschende vom Zentrum für Kognition, Lernen und Gedächtnis (CCLM) erklären, was im Kopf passiert, wenn wir über einen Zebrastreifen schreiten.
Warum das Zebra Streifen hat, ist eine nicht eindeutig geklärte Frage. Warum Strassen aber Zebrastreifen aufweisen, das weiss der Fachverband Fussverkehr Schweiz: Die Idee des Zebrastreifens geht bis ins römische Reich zurück, als Trittinseln quer zur Strasse den Fussgängern die Strassenüberquerung ermöglichten und der Tempoverlangsamung von Pferdewagen dienten. Heute dienen die Zebrastreifen der sicheren Überquerung der Strasse für die Fussgänger; in der Schweiz gibt es rund 40'000 bis 50'000 Zebrastreifen. Gelb sind sie seit einem Entscheid des Bundesrates 1936 – diese Farbe wurde im Strassenverkehr noch nicht anders verwendet. So harmlos wie Zebras sind Fussgängerstreifen aber nicht. Gemäss der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) verunfallen jährlich rund 700 Fussgänger schwer und 80 tödlich. Was das mit dem Gehirn zu tun hat? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Zentrums für Kognition, Lernen und Gedächtnis (CCLM) der Universität Bern liefern Antworten.
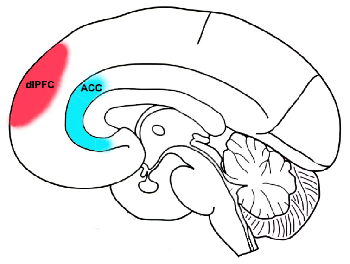
Die Hirnareale, die bei der kognitiven Kontrolle involviert sind, sind zum einen der dorsolaterale Präfrontalkortex (dlPFC) und zum anderen der anteriore cinguläre Cortex (ACC). (Bild: zvg)
Augenbewegungen werden gemessen
Die Forschungsgruppe um Urs Mosimann, René Müri und Tobias Nef verfolgt ein Projekt zu älteren Fussgängerinnen und Fussgängern im Strassenverkehr und für Trainings zur Förderung der sicheren Verkehrsteilnahme. Ziel ist es, die mentalen Prozesse bei der Strassenüberquerung genauer zu verstehen und kognitive Fehler, die zu Unfällen führen können, zu identifizieren. Im Experiment überqueren die Probanden im Simulationslabor eine virtuelle Strasse. Die Simulation beinhaltet Autofahrer, Velofahrerinnen sowie andere Fussgänger. Die Probanden erhalten die Aufgabe, die Strasse möglichst sicher zu überqueren. Während des Versuchs tragen die Probanden eine Augenkamera, welche die Augenbewegungen aufzeichnet. Damit können die Blicke nach links und nach rechts unmittelbar vor dem Überqueren gemessen werden.
Diese Daten geben den Forschern Hinweise auf die spezifischen Herausforderungen an ältere Menschen beim Überqueren von Strassen. Dazu gehören zum Beispiel die korrekte Wahrnehmung von Position und Geschwindigkeit von herannahenden Autos, die damit verbundene Antizipation einer Verkehrslücke und die zeitkritische Entscheidung, los zu gehen oder stehen zu bleiben. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse sollen dereinst geeignete Trainingsprogramme entwickelt werden, die älteren Menschen helfen, die verkehrsrelevanten kognitiven Fähigkeiten aktiv zu trainieren und möglichst lange zu erhalten.
«Kognitive Kontrolle»
Die Tücken des Fussgängerverkehrs betreffen aber keinesfalls nur ältere Menschen. Was, wenn bei der Strassenüberquerung auf halber Strecke die Tour de France um die Ecke radelt? Unweigerlich braucht es in einer solch aussergewöhnlichen Situation auch bei jungen Menschen die Fähigkeit, schnell das Verhalten anpassen zu können, um trotz Hindernissen ans Ziel zu gelangen. Psychologen bezeichnen diese Fähigkeit als «kognitive Kontrolle» – das Forschungsgebiet von Beat Meier: Er stellte sich die Frage, wie das Gehirn auf solche Konfliktsituationen reagiert. Frühere Studien zeigen, dass es im Gehirn Areale gibt, die besonders auf Situationen ansprechen; darunter der vordere cinguläre Cortex (ACC, Bild). Dieses Areal signalisiert in einer Konfliktsituation, dass etwas nicht in Ordnung ist und dass das Verhalten angepasst werden muss – im Strassenverkehr etwa mit einem Sprung in den Strassengraben.
Diese Anpassung des Verhaltens wird vom so genannten dorsolateralen präfrontalen Cortex (dlPFC, Bild) vorgenommen, der jüngsten Struktur in der Entwicklung des menschlichen Gehirns. Kürzlich hat Meier mit seiner Doktorandin Alodie Rey-Mermet im Fachmagazin Journal of Experimental Psychology publiziert, ab welchem Zeitpunkt solche Verhaltensänderungen vorgenommen werden. Das verblüffende Resultat: Weder die Konfliktmenge noch die Konfliktquelle spielen eine Rolle. Das heisst: Dem Gehirn ist es egal, ob ein einzelner Fahrradfahrer, die ganze Tour de France oder ein tollwütiges Schaf unerwartet um die Ecke prescht. Hauptsache ist, dass das Gehirn auf irgendeine Weise erfährt, dass die Kontrolle hochgefahren und das Verhalten angepasst werden muss.
Das Zusammenspiel der Nervenzellen
Die Frage drängt sich auf, woher die Hirnzellen eigentlich wissen, was zu entscheiden ist. Der Experte im Bereich «Computational Neuroscience», Walter Senn, modelliert solche Vorgänge mit Mathematik. Es gibt im Gehirn verschiedene sensorische Eingänge, die Informationen aus der Aussenwelt kodieren. Zum Beispiel gibt es visuelle Nervenzellen – also Neurone, die registrieren, welche Farbe die Ampel hat oder wie weit weg ein heranrollendes Auto ist. Weiter gibt es auditorische Neurone, die zum Beispiel Motorgeräusche kodieren.
Alle Informationen der sensorischen Neuronen werden schliesslich mit unterschiedlicher Relevanz an eine Population von so genannten Entscheidungsneuronen im dorsolateralen präfrontalen Cortex gesendet. Jedes Neuron in dieser Population muss für sich entscheiden, ob die Strasse überquert werden soll oder nicht. Ausgeführt wird die Handlung aber erst dann, wenn sich die Mehrheit dieser Neurone dafür entschieden hat.
Lernen durch erleben
Warum manchmal auch falsche Entscheidungen getroffen werden? Weil das Netzwerk noch nicht genug gelernt hat. Man muss den Prozess der Strassenüberquerung wiederholt erleben, damit die Neuronen lernen, richtig zu entscheiden. «Lernen basiert auf der Auswertung einer internen Rückmeldung, die zum Beispiel mit der Ausschüttung von Adrenalin in einer gefährlichen Situation einhergeht», so Walter Senn. Nur durch häufige Wiederholung lernt man, die sensorischen Signale mit den eigenen motorischen Fähigkeiten richtig einzuschätzen. «Und im Alter, wenn insbesondere die motorischen Fähigkeiten abnehmen, muss die automatisierte Handlung durch eine bewusste Entscheidungsfindung ergänzt werden», erklärt Urs Mosimann.

Das CCLM-Team: Beat Meier, Urs Mosimann, René Müri, Tobias Nef und Walter Senn. (Bilder: zvg)
Das CCLM an der Uni Bern
Beat Meier, Urs Mosimann, René Müri, Tobias Nef und Walter Senn sind Professoren und Forschungsgruppenleiter im Strategischen Forschungszentrum CCLM (Zentrum für Kognition, Lernen und Gedächtnis) der Universität Bern. Das CCLM hat zum Ziel, das Denken, Lernen und Erinnern durch interdisziplinäre Forschung besser zu verstehen, Defizite zu erkennen und gezielt dagegen vorgehen zu können. Zum CCLM gehören ebenfalls ein Dienstleistungszentrum und ein Ausbildungsprogramm für Doktoranden.