Berner Physiker experimentieren in China
Berner Physiker schicken eine Funkenkammer nach China. Mit dem Experiment wollen sie in einer Wander-Ausstellung anlässlich der Würdigung der diplomatischen Beziehungen Schweiz-China Einsteins Relativitätstheorie zeigen. Die Ausstellung begann am 30. Mai in Peking.
Die Uni Bern demonstriert den Chinesen die Relativitätstheorie: Die Einstein-Ausstellung des Historischen Museums Bern ist seit dem 30. Mai während rund zwei Jahren in den vier Städten Peking, Hongkong, Shanghai und Guangzhou zu sehen. Nebst rund 200 Objekten, Texten und Filmen geht auch eine Funkenkammer der Universität Bern mit auf «China Tour». Die rund zwei mal zwei Meter grosse Apparatur soll die Relativitätstheorie, die Albert Einstein zum grossen Teil in Bern erarbeitet hat, veranschaulichen. Die China-Ausstellung steht unter dem Patronat von Bundesrätin und Aussenministerin Micheline Calmy-Rey und H.E. Yang Jiechi, Minister für ausländische Angelegenheiten der Republik China. Die beiden Länder feiern mit der Einstein-China-Tour 60 Jahre diplomatische Beziehungen.
Zeit und Raum sind «relativ»
In seiner Relativitätstheorie setzt Einstein Raum und Zeit in einen relativen Zusammenhang. Er zeigt, dass die Zeit, die ein Objekt braucht, um sich im Raum von A nach B zu bewegen, nicht etwa absolut, sondern vielmehr abhängig vom Bezugssystem des Beobachters relativ zum beobachteten Objekt ist: Gemäss Relativitätstheorie dauert ein Vorgang in einem sich bewegenden Raumschiff für einen dort anwesenden Beobachter kürzer als für einen ruhenden Beobachter, der den gleichen Vorgang zum Beispiel von der Erde aus verfolgt. «Bewegte Uhren laufen langsamer», fasst Hans Peter Beck, Teilchenphysiker am Laboratorium für Hochenergiephysik der Universität Bern, zusammen. Dieses physikalische Phänomen werden die Berner Physiker den Chinesinnen und Chinesen in der so genannten Funkenkammer demonstrieren.
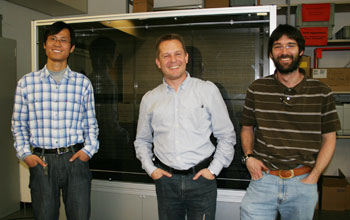
Kleinstteilchen sichtbar machen
Die Funkenkammer ist eine Hightech-Installation, die Myonen registriert und sie sichtbar macht. Myonen sind kleine Elementarteilchen, und pro Sekunde etwa prallt ein Myon auf der Fläche einer Handgrösse auf die Erde. Myonen entstehen, wenn Protonen als kosmische Strahlung mit annähernd Lichtgeschwindigkeit durch das Weltall rasen und schliesslich in 10 bis 20 Kilometer Höhe mit Molekülen der Erdatmosphäre zusammenstossen. Bei diesen hochenergetischen Kollisionen entstehen vor allem Pionen, welche nach kurzer Flugstrecke in Myonen zerfallen. Myonen haben eine äusserst kurze Lebensdauer von rund zwei Mikrosekunden (2,2 x 10-6 sec), bevor sie schliesslich in Elektronen und Neutrinos weiter zerfallen, die schliesslich stabile Teilchen sind.

Schnelle Teilchen leben länger
Ohne Relativitätstheorie könnten die kurzlebigen Myonen in dieser Zeit vom Entstehen bis zu ihrem Zerfall nur 660 Meter Distanz zurücklegen. Und nun kommt Einstein ins Spiel: «Seine Theorie sagt voraus, dass Myonen, die schnell unterwegs sind, weite Distanzen zurücklegen können, da ihre Lebenszeit durch die Bewegung für einen still stehenden Beobachter verlängert wird», führt der Berner Physiker Michele Weber aus.
Den Beweis dafür liefert eine zweite Funkenkammer, die auf dem Jungfraujoch auf 3571 Metern über Meer steht. Der Vergleich der Anzahl gemessener Myonen auf der Jungfrau und in der Funkenkammer am Physikalischen Institut in der Stadt Bern auf rund 550 Meter über Meer zeigt: «Die Raten sind fast gleich hoch», sagt Weber – dies obwohl zwischen den beiden Standorten ein Höhenunterschied von fast drei Kilometern besteht; ohne Einsteins Erklärungen müssten auf dem Jungfraujoch aufgrund ihrer Lebensdauer rund 100-mal mehr Myonen gezählt werden. Das Funkenkammer-Experiment beweist also: Schnelle Myonen sind in der Lage, mehrere Kilometer zurückzulegen. «Je schneller ein Myon unterwegs ist, desto länger lebt es und kann darum weiter fliegen – dank der Relativität von Zeit und Raum», fasst Hans Peter Beck zusammen.
Chinese zum Training in Bern
Was abstrakt klingt, macht die Funkenkammer zusätzlich visuell sichtbar: Tritt nämlich ein Myon in die mit Edelgas gefüllte Kammer ein, leuchtet sein Weg pinkfarben auf; ihre Ladung wird nämlich auf einer gitterartigen Struktur abgeleitet und so kann der Weg des Teilchens nachgewiesen werden. Auch der Chinese Lichao Tian ist begeistert. Einen Monat lang weilte der Physik-Student aus Peking in Bern, um Aufbau und Funktion der Funkenkammer kennen zu lernen. Lichao Tian wird während der Wanderausstellung den technischen Support sicherstellen. «Es ist eine gute Idee, dass China auf diese Art mehr über Wissenschaft, Einstein – und die Schweiz erfährt», ist Tian sicher. An der China-Ausstellung werden die Funkenkammern am Historischen Museum Bern und auf dem Jungfraujoch über Internet live dazu geschaltet – und so zeigt Bern den Chinesen, wie relativ Zeit und Raum ist.