Department of Clinical Research
Eva Segelov: Eine Karriere für bessere Forschung
Gute Forschung muss dort ansetzen, wo sie gebraucht wird: beim Menschen – das ist die Vision von Eva Segelov. Seit Ende 2022 leitet die australische Onkologin und klinische Forscherin das Department of Clinical Research an der Universität Bern.

Dass sie Ärztin werden wollte, wusste Eva Segelov schon früh. Ihr Vater war orthopädischer Chirurg, und sie sah, wie viel er für andere Menschen bewirken konnte. Doch sie wusste auch: Für die Chirurgie fehlte ihr wohl das handwerkliche Geschick. So arbeitete sie nach Abschluss ihres Medizinstudiums an der University of Sydney in unterschiedlichen Fachgebieten, um herauszufinden, welche Spezialisierung ihr am besten lag. Die Onkologie mied sie zunächst: Zu negativ war das Bild, das sie von der Disziplin hatte. «In den frühen 90er Jahren waren die Therapiemöglichkeiten bei Krebs noch sehr beschränkt», sagt Segelov rückblickend. «Es gab noch keine guten Mittel gegen Übelkeit, und viele Menschen mit Krebs lagen schwerkrank und ohne Aussicht auf Heilung im Spital. Ich hatte keine Lust, Menschen mit schweren Nebenwirkungen zu quälen, ohne sie wieder gesund zu machen.»
Das Leben von Patientinnen und Patienten verbessern
Doch bei einer ihrer Assistenzstellen war ein Ausbildungsabschnitt in der onkologischen Abteilung Pflicht. Und bereits am ersten Tag dort wusste Segelov: Sie hatte das Fachgebiet gefunden, in dem sie fortan arbeiten wollte. Denn unter den Menschen, die ambulant zur Behandlung oder in Kontrolluntersuchungen kamen, waren doch einige, die geheilt werden konnten – und noch mehr, denen sie als Onkologin zumindest helfen konnte, für ihre verbleibende Zeit Lebensqualität zurückzugewinnen und noch wichtige Meilensteine zu erreichen. Zudem wurde Segelov bewusst, wie wichtig in der Onkologie gute Kommunikation, Empathie und Fingerspitzengefühl sind, um für jede und jeden die jeweils beste Behandlung zu finden.
Von da an spezialisierte sie sich in der klinischen Onkologie. 1997 promovierte sie an der University of Sydney. Danach arbeitete sie an verschiedenen australischen Universitätskliniken, behandelte Patientinnen und Patienten mit Brustkrebs, Tumoren im Verdauungstrakt und sogenannten neuroendokrinen Tumoren. Bei Letzteren handelt es sich um Tumore, die aus neuroendokrinen Zellen hervorgehen, also Zellen, welche Hormone oder hormonähnliche Substanzen bilden. Auch angesichts der damals noch beschränkten Behandlungsmöglichkeiten seien klinische Studien immer zentraler Bestandteil ihrer Arbeit gewesen. «Ich wollte verstehen, warum eine Therapie bei der einen Person wirkt, bei der anderen aber nicht», sagt Segelov. «Forschung war für mich immer der Weg, die medizinische Versorgung zu verbessern.»
Subscribe to the uniAKTUELL newsletter
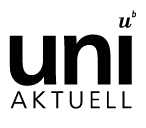
Discover stories about the research at the University of Bern and the people behind it.
Eine international vernetzte Karriere
Während viele ihrer Kolleginnen und Kollegen nach Abschluss der Facharztausbildung ein paar Jahre im Ausland forschten, blieb Segelov in Australien – zunächst in Sydney, ab 2017 in Melbourne. «Mein Mann ist ebenfalls Mediziner mit Spezialisierung, und wir wollten eine Familie gründen. Zwei passende Stellen am selben Ort im Ausland zu finden, schien uns schlicht unwahrscheinlich», erzählt sie.
Segelov brachte einen Sohn und zwei Töchter zur Welt und baute sich als berufstätige Mutter ein globales Forschungsnetzwerk auf. Sie leitete internationale klinische Studien, etwa zu neuroendokrinen Tumoren; gründete eine Forschungsgruppe mit Forschenden aus Kanada und Neuseeland und war an der Entwicklung globaler Leitlinien beteiligt, um die Qualität klinischer Studien einheitlich zu beurteilen. «Man muss nicht zwingend im Ausland leben, um international zu arbeiten», sagt sie. «Aber ich verspürte stets den Wunsch, einmal in einem anderen Land zu wirken.»
Ein Zufall – und ein Neuanfang in der Schweiz
Kurz vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie kam dann die Gelegenheit in Form einer E-Mail: Eine internationale Personalagentur suchte im Auftrag der Universität Bern eine Direktorin für das 2019 gegründete Department of Clinical Research (DCR) (siehe Kasten). Segelov erinnert sich: «Ich überflog die Stellenausschreibung und verschob sie dann direkt in den Papierkorb.» Doch eine Woche später holte sie die Nachricht wieder hervor. Ihre Kinder waren inzwischen erwachsen und ausgezogen, sie selbst bereit für einen Neuanfang. Sie fragte ihren Mann, ob er mit ihr in die Schweiz ziehen würde, falls sie die Stelle bekäme. «Wieso eigentlich nicht?», lautete seine Antwort.
Segelov überzeugte im Bewerbungsverfahren und zog mit ihrem Mann in die Bundeshauptstadt. Im Dezember 2022 übernahm sie die Leitung des DCR.
«Forschung war für mich immer der Weg, die medizinische Versorgung zu verbessern.»
Eva Segelov
Als sie vor dem Umzug ihr Haus räumte, stiess sie auf einen Brief, den sie in den 1980er-Jahren als Medizinstudentin ihrem Vater geschrieben hatte. Von einer Reise durch Europa schrieb sie damals über Bern: «Es ist so kalt, ich verstehe nicht, wie Menschen hier leben können!» Heute gefällt es ihr und ihrem Mann sehr gut in Bern – auch im Winter: die Stadt selbst, wie schnell man in der Schweiz auch ohne Auto überall ist, die Nähe zur Natur. Dass die Häuser hier anders als in Melbourne auch im Winter gut geheizt sind. Vor allem aber geniesst Eva Segelov die Chance, als Direktorin des Department of Clinical Research nun zum ersten Mal in ihrem Leben ihre gesamte Aufmerksamkeit der Forschung zu widmen und etwas Einzigartiges aufzubauen.
Forschung, die für Menschen relevant ist
Die Schicksale der Menschen, die sie behandelt hat, haben sie stets bewegt. Bis heute erinnert sie sich an die meisten ihrer Namen und Geschichten, und bis heute erreichen sie Nachrichten und Briefe von Menschen, die den Krebs überlebt haben. Die Arbeit als behandelnde Ärztin aufzugeben, sei nicht leicht gewesen. «Aber in meiner neuen Position kann ich mehr als nur einzelnen Patientinnen und Patienten helfen», sagt Segelov. «Hier kann ich meine ganze Erfahrung einsetzen, um medizinische Forschung effizienter, zugänglicher und praxisnäher zu machen – und so mehr für die ganze Gesellschaft erreichen.»
«In meiner neuen Position kann ich mehr als nur einzelnen Patientinnen und Patienten helfen.»
Eva Segelov
Mitdenken erwünscht: Patient and Public Involvement
Stolz ist sie etwa auf das Panel for Patient and Public Involvement (PPI), das sie am DCR aufgebaut hat: eine Gruppe von 40 bis 50 Personen aus diversen Patientenorganisationen und der breiten Öffentlichkeit, die bei der Planung und Umsetzung klinischer Studien systematisch mit einbezogen werden. PPI hilft beispielsweise zu beurteilen, ob die Information und Fragebögen zu geplanten Studien für Laien gut verständlich sind. Es liefert auch Einschätzungen dazu, ob Forschungsfragen relevant sind und das Studiendesign gut umsetzbar ist.
Ob die Patientinnen und Patienten etwa lieber alle Untersuchungen an einem Tag machen würden oder gestaffelt über mehrere Wochen verteilt. «Eine alleinerziehende Mutter sieht das anders als ein Vollzeit-Student oder eine Rentnerin», sagt Segelov. «Wenn wir Forschung mit den Menschen machen anstatt nur über sie, hilft uns das, die begrenzten Forschungsgelder nur für Studien einzusetzen, die am Ende wirklich relevant und machbar sind.»
Studien neu denken: Dezentral und digital
Ein weiteres Anliegen von Segelov ist die Modernisierung von Studienmodellen. «Heute finden längst nicht mehr alle klinischen Studien im Spitalbett statt», betont sie. In Australien war sie an der Entwicklung so genannter Teletrials beteiligt: Studien, bei denen Teilnehmende über Hausärztinnen und Hausärzte, Video und digitale Tools eingebunden werden. «Das eröffnet neue Möglichkeiten – gerade für Menschen in Randregionen oder mit Betreuungsaufgaben, die sonst kaum in solchen Studien mitmachen würden», sagt Segelov. Auch in tragbaren medizinischen Geräten und elektronischen Tagebüchern sieht sie grosses Potenzial, die Lebensrealität von Studienteilnehmenden besser abzubilden und medizinische Forschung dadurch aussagekräftiger zu machen.
«Forschung mit anstatt über Menschen: So können begrenzte Forschungsgelder für relevante und machbare Studien eingesetzt werden.»
Eva Segelov
Gleichstellung: Mehr Vorbilder, mehr Vielfalt
Besonders am Herzen liegen Eva Segelov die Gendermedizin und die stärkere Berücksichtigung von Frauen in klinischen Studien. «Noch immer sind Frauen dort oft unterrepräsentiert, obwohl Krankheiten bei ihnen anders verlaufen oder Therapien anders wirken», sagt sie. Auch in leitenden Funktionen der medizinischen Forschung seien Frauen bis heute klar in der Minderheit. «Es ist nach wie vor schwieriger für Frauen, in der Forschung Karriere zu machen.
Selbst als Professorin wird man als Frau oftmals weniger ernst genommen als männliche Kollegen.» So habe sie etwa schon mehrmals erlebt, dass ein männlicher Kollege bei einem Meeting aufstand und sich für alle hörbar Kaffee machte, sobald sie als einzige Frau im Raum das Wort ergriff. Als Mentorin im Netzwerk FELS (Female Empowerment in Life Sciences) will Segelov daher andere Frauen stärken. Ihr Rat: «Nehmt euch Zeit, sucht Verbündete – und bleibt sichtbar. Die Wissenschaft braucht euch.»
Zur Person

Tina Hascher
is a full professor and Head of the Division of School and Teaching Research at the Institute of Educational Science at the University of Bern. She conducts research into emotions, motivation and well-being in learning and educational contexts.
Bernese space exploration: With the world’s elite since the first moon landing
When the second man, "Buzz" Aldrin, stepped out of the lunar module on July 21, 1969, the first task he did was to set up the Bernese Solar Wind Composition experiment (SWC) also known as the “solar wind sail” by planting it in the ground of the moon, even before the American flag. This experiment, which was planned, built and the results analyzed by Prof. Dr. Johannes Geiss and his team from the Physics Institute of the University of Bern, was the first great highlight in the history of Bernese space exploration.
Ever since Bernese space exploration has been among the world’s elite, and the University of Bern has been participating in space missions of the major space organizations, such as ESA, NASA, and JAXA. With CHEOPS the University of Bern shares responsibility with ESA for a whole mission. In addition, Bernese researchers are among the world leaders when it comes to models and simulations of the formation and development of planets.
The successful work of the Department of Space Research and Planetary Sciences (WP) from the Physics Institute of the University of Bern was consolidated by the foundation of a university competence center, the Center for Space and Habitability (CSH). The Swiss National Fund also awarded the University of Bern the National Center of Competence in Research (NCCR) PlanetS, which it manages together with the University of Geneva.